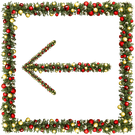Haselnüsse

Jetzt mal Hand aufs Herz – wer hat nicht direkt an „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedacht“?
Haselnüsse und Weihnachten haben eh eine lange, kulturell tief verwurzelte Verbindung – aber dann noch den Film im Hintergrund, während man in der Weihnachtsbäckerei zaubert … ein Traum!
Haselnüsse gehören zu den klassischen Nüssen, die in der Advents- und Weihnachtszeit vermehrt gegessen und verwendet werden. Gerne auch auf dem bunten Teller.
Allerdings sind Haselnüsse Bestandteil vieler Weihnachtsplätzchen und Gebäcke.
Haselnüsse findet man als ganze Nüsse in Schokolade, Pralinen oder auch als Nougat, was meist aus Haselnüssen hergestellt wird. Gemahlen oder gehackt als aromatische Zutat in Backrezepten usw.
Oder in Flüssiger Form auch als Schnaps … Ich hab da nen feinen Tropfen stehen: Kakao mit Nuss … kann ich nur empfehlen.
Haselnüsse werden im Herbst geerntet und sind zur Winterzeit frisch und reichlich verfügbar – das macht sie ideal für die Weihnachtszeit.
Haselnüsse sind in Deutschland heimisch und wachsen hier schon sehr lange. Es ist zwar nicht genau bekannt, wann die ersten Haselnüsse in Deutschland auftauchten, aber das dürfte schon ne Weile her sein. In alten Bräuchen galten Nüsse als Glücksbringer und wurden in Weihnachtsrituale integriert. So war es früher z.B. üblich, dass es zum Nikolaustag überwiegend Äpfel, Süßigkeiten und eben Nüsse gab. Diese Tradition lebt ja heute in Form von Nikolausstiefeln und Weihnachtstellern weiter. Und auch wenn die Haselnuss in Deutschland heimisch ist … Sie kommt, genauso wie der heilige Nikolaus (von Myra), überwiegend aus der Türkei. Zumindest, wenn man sich die Nüsse im Supermarkt holt.
Jetzt haben wir zwar die Haselnüsse im Haus, aber irgendwas brauchen wir da noch …. Ach ja – den guten alten Nussknacker! Der Nussknacker ist eine klassische Weihnachtsfigur und seine Existenz ist ohne Nüsse (wie eben Haselnüsse) kaum denkbar. Wobei ein schöner Nussknacker aber auch sehr dekorativ ist. Ich habe z.B. einen wunderschönen Nussknacker aus dem Erzgebirge, den ich aber nicht zum Nüsse knacken nehme^^
Den Nussknacker finden wir zudem auch in der Musik. Von Tschaikowsky in diesem Falle. Aber auch viele Weihnachtslieder, Geschichten und Gedichte erzählen von Haselnuss … ja ja … und Mandelkern … mögen Zippelmützen gern ;)
In älteren Weihnachtsgeschichten wird das Knacken von Nüssen oft als Teil des Familienabends beschrieben. Heute sind es dann eher Rätsel-Nüsse. Aber egal in welcher Form – Nüsse, bzw. hier jetzt Haselnüsse gehören zum Advent und Weihnachtsfest dazu. Ich freue mich jetzt schon darauf, mit Haselnüssen zu backen und Weihnachtslieder zu hören …

Heidentum

Beim Heidentum dreht es sich hauptsächlich um die Verehrung der Natur, den Glauben an verschiedene Götter und Göttinnen und die Durchführung von Ritualen, oft im Zusammenhang mit den Jahreszeiten und dem landwirtschaftlichen Zyklus.
Es geht auch um die Wiederbelebung oder die Pflege von vorchristlichen Traditionen und Bräuchen, wie beispielsweise der nordischen oder germanischen Mythologie.
Und was hat Heidentum jetzt mit Weihnachten zu tun? Ich spoiler mal … eine ganze Menge!
Die Verbindung zwischen Heidentum und Weihnachten ist ein faszinierendes Thema. Denn viele der heutigen Weihnachtsbräuche und auch Symbole sind tief in heidnischen Traditionen verwurzelt.
Doch bevor wir uns einzelne Begriffe vornehmen, schauen wir erst einmal auf die „Feiertage“.
Im Grunde genommen gibt es da nur ein Hauptfest – Die Wintersonnenwende. Es ist der Tag mit dem kürzesten Tageslicht und das war/ist für viele heidnische Kulturen der heiligste Moment überhaupt. Ab da werden die Tage wieder länger und der Spuk hat ein Ende. Na ja – nicht ganz^^ Wir haben ja auch noch die Rauhnächte im Gepäck. Die Rauhnächte sind eine Zeit von 12 Nächten, die zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar liegen. Und ich kann euch sagen … das ist nichts für Schisser! Aber der Begriff wird in diesem Weihnachtslexikon auch noch zerpflückt.
Die Wintersonnenwende ist extrem wichtig im Heidentum. Es ist die Rückkehr des Lichts und steht sinnbildlich für Wiedergeburt und Hoffnung.
Ihr seht – die Kluft zwischen Heiden und Christen ist gar nicht so groß.
Vielleicht war es den Christen ein zu großes Durcheinander, was den heidnischen Zeitplan angeht. Die Römer feierten Saturnalia ab dem 17. Dezember. Beim nordisch/germanischen Julfest sieht es etwas anders aus. Je nach Kultur wird das zwischen der Wintersonnenwende und Anfang Februar gefeiert.
Dann kamen die Christen und haben gesagt: „So geht das ja nicht“ … und so wurde das christliche Weihnachtsfest auf den 25. Dezember gelegt ... vermutlich um diese bereits beliebten heidnischen Feste zu "überlagern" und zu christianisieren. Aber die Christen waren ja nicht blöd … Die Kirche adaptierte heidnische Bräuche bewusst, um den Übergang zum Christentum leichter zu gestalten. Weihnachten wurde nicht als das tatsächliche Geburtsdatum Jesu gefeiert (das ist historisch nicht belegt), sondern wurde als geistlicher Kontrapunkt zur Sonnenwende gesetzt.
Man liest bei mir gelegentlich einen kritischen Unterton. Das liegt einfach daran, weil die Kirche so allmächtig tut. Ja klar – Heiden glauben an mehrere Götter und sind der Natur eng verbunden. Wer sich gut mit Kräutern auskannte, wurde schnell als Hexe betitelt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt … aber dem Jesukind Weihrauch und Myrrhe als Geschenk eintüten … tolle Doppelmoral^^
Kommen wir mal zu den Brauchtümern und Symbolen, die sich das Christentum vermeintlich bei den Heiden abgekupfert hat. Fangen wir mit dem Weihnachtsbaum an. Den Baumkult hatten schon die Germanen und Kelten.
Der Weihnachtsmann – bzw. der Nikolaus … Das ist eine Mischfigur aus Odin, heidnischen Gabenbringer (Nüsse und Obst) – und dem Bischof Nikolaus.
Die Rauhnächte … Im Christentum stehen sie für Einkehr, Reflexion und der Vorbereitung auf das neue Jahr. Im Heidentum ist es die Geisterzeit zwischen den Jahren.
Und wie christlich ist es, Geschenke zu verteilen? Das römische Fest „Saturnalia“ diente dazu Geschenke zu Ehren des Gottes Saturn zu geben.
Zum Schluss gehen wir an das Weihnachtsessen. In vielen heidnischen Kulturen wurde zur Sonnenwende ein üppiges Festmahl zubereitet – als Dank und Hoffnung.
Es sind also viele Bräuche, die einen heidnischen Ursprung haben … und die wir heute als ganz normal – ja eben christlich ansehen. Mir ist das wurscht – das kann jeder halten, wie ein Dachdecker. Mir geht nur diese totale Anspruchnahme auf den Weihnachtskeks … aber das macht man heutzutag scheinbar so^^
Weihnachten ist halt eine Mischung aus christlichen Inhalten und heidnischen Formen. Die Wurzeln reichen tief in die Mythologien und Bräuche Europas hinein. Für viele Menschen ist das Wissen darüber eine Bereicherung – es zeigt, wie alte und neue Weltbilder ineinanderfließen und sich weiterentwickeln. Versucht doch mal, Beides zu verinnerlichen. Ach nee … das machen ja viele schon – spätestens Silvester. Gerade „zwischen den Jahren“ ist es die magische Zeit, wo viele Bräuche wie Bleigießen, Traumdeutung oder Orakel nahezu zelebriert werden.

Heiligabend

Heiligabend ist komisch! In der Regel fällt der Heiligabend auf den 24. Dezember … und doch kommt der für viele Menschen immer ganz plötzlich^^ Dabei ist das einer der zentralen Tage im christlichen Jahreskreis. Wobei man eigentlich eher Abend sagen muss. Denn der heilige Morgen und Mittag vor dem Heiligabend ist bei den Meisten ja dann doch eher höllisch stressig. Viele gehen noch den halben Tag arbeiten, oder endlich dann doch Geschenke besorgen, und dann wird das große Familienfest vorbereitet. Der Heiligabend ist ja familiär und kulturell stark durch Traditionen geprägt. Da unterscheiden sich die kirchlichen und weltlichen Vorgehensweisen wie Himmel und Hölle.
Ganz wichtig dabei: Heiligabend ist nicht Weihnachten! Genau genommen ist der Heiligabend der krönende Abschluss der Adventszeit. Das eigentliche Weihnachtsfest beginnt erst mit der Christmette am späten Abend oder um Mitternacht, also mit dem 25. Dezember. In katholischen und evangelischen Gemeinden ist Heiligabend einer der meistbesuchten Tage im Kirchenjahr. Da gehen dann sogar oft die hin, die bei Religion zuerst an ihren Fußballverein denken … Ich sach nur^^
Manche ziehen auch das komplette Programm durch … mit Familiengottesdienst, Christvesper und die Christmette.
Ein ähnliches Programm wird am weltlichen Heiligabend abgezogen.
In vielen deutschsprachigen Ländern ist der 24. Dezember der Hauptfesttag von Weihnachten - anders als z. B. in Großbritannien oder den USA, wo der 25. Dezember dominiert. Es ist oft DER familiäre und kulturelle Höhepunkt mit Bescherung, Festessen und gewissen anderen Traditionen. Manche Familien haben z.B. einen Kultfilm, der unbedingt an Heiligabend geschaut werden muss. Manchmal sogar mit integriertem Trinkspiel^^
Heiligabend ist für viele Menschen aber auch ein Moment der Einkehr, der Erinnerung, des Wunschs nach Frieden. Auch außerhalb religiöser Überzeugungen. Da wird der Heiligabend dann eben eher ruhig verbracht. Aber egal, wie der Heiligabend gefeiert wird … Es ist eine Mischung aus christlicher Liturgie, bürgerlicher Familienkultur des 19. Jahrhunderts und alten heidnischen Traditionen. Ich wünsche jedenfalls jedem einen schönen Heiligabend.

Heilige drei Könige

Die Heiligen drei Könige waren die drei Weisen aus dem Morgenland. Ob es nun wirklich Könige waren … kein Mensch weiß das. Aber sie waren wohl weise und damit Höhergestellte. Sie waren Sterndeuter, Magier und Philosophen. Sternendeuter kann hinhauen, denn schließlich folgten sie einem Stern, der sie zum Stall von Bethlehem führte. Magier? Schwierig … im Mittelalter hätte man vielleicht von Hexen geredet, denn schließlich brachten sie Weihrauch und Myrrhe mit. Zu Philosophen kann ich nicht viel sagen. Weiß der Henker, was sie dem kleinen Jesus da erzählt haben.
Der Witz ist ja, dass man erst gar nicht so wirklich wusste, um wie viele Weisen es sich da handelt.
Origenes war ein frühchristlicher Bibelkommentator. Und eben dieser Origenes sprach erstmals von der Dreizahl der Magier, die er aus den drei Geschenken herleitete. Einfache Logik^^
Der Ausdruck Könige wurde dann im 3. Jahrhundert von Tertullian und anderen Kirchenschriftstellern gebraucht.
Ihre heutigen Namen tauchten erstmals im 6. Jahrhundert auf und wurden im 9. Jahrhundert volkstümlich.
Seit dem 8. Jahrhundert werden sie also Caspar, Melchior und Balthasar genannt.
Tatsächlich waren sie wohl Priester des Zoroaster-Kultes in Persien. (Zoroaster gilt als wesentlicher Begründer des Monotheismus und als erster, der ein Weiterleben der Seele des Menschen nach dem Tod verkündete).
Klingt alles nicht ganz so weltlich … aber kommen wir zu den drei Königen im Einzelnen.
Die drei Könige kamen quasi in drei Generationen zur Krippe um Jesus zu besuchen und zu beschenken. Der Erzählung nach war Casper der Jungspund bei den drei Königen und als „People of Colour“ für Afrika unterwegs. Damals waren ja nur drei Weltteile bekannt. Dem Casper wird das Geschenk der Myrrhe zugeordnet.
Melchior war ein Mann mittleren Alters und war der Erzählung nach Europäer. Er brachte dem Jesukind das Gold mit.
Als Greis wird Balthasar betitelt. Vielleicht brachte er deshalb den Weisheitsschatz Weihrauch mit nach Bethlehem. Sein Herkunftsweltteil soll Asien gewesen sein.
Diese Zuordnungen kamen im 12. Jahrhundert auf, also lassen wir sie mal so stehen.
Nun ist es ja so, dass die Krippe unterm Tannenbaum erst komplett ist, wenn alle da sind. Oft ist es so, dass die heiligen drei Könige erst am Dreikönigstag an oder in die Krippe gestellt werden. Und wenn die Weihnachtsdeko samt Baumschmuck und Krippe in der Kiste verschwindet, ist das Thema erledigt … Aber was geschah mit Caspar, Melchior und Balthasar nach der ganzen Geschichte?
Nach dem Besuch bei Jesus, einem Heißgetränk und der Übergabe ihrer Geschenke, kehrten die Heiligen Drei Könige auf einem anderen Weg nach Hause zurück, da sie von einem Engel im Traum gewarnt wurden, nicht zu König Herodes zurückzukehren. Dieser hatte sie zuvor gebeten, ihm den Ort zu nennen, an dem sich das neugeborene Kind befand, um ihm ebenfalls zu huldigen. Die Warnung des Engels verhinderte, dass die Könige Herodes' Plan, Jesus zu töten, unterstützen konnten. Was dann mit den drei Weisen geschehen ist … das steht in den Sternen.

Heimlichkeit

Das Thema „Heimlichkeiten und Weihnachten“ ist spannender, als es auf den ersten Blick scheint – denn Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe und der Familie, sondern auch das der kleinen Geheimnisse, Überraschungen und stillen Rituale.
Es hat was mystisches … sogar etwas von Magie.
Es fängt ja schon bei den Geschenken an. Ich empfehle ja, schon im Januar genau hinzuhören und evtl. die ersten Geschenke zu besorgen. Jetzt ist es natürlich nicht einfach, dieses Geheimnis bis zur Bescherung für sich zu behalten. Vor allem darf es nicht so heimlich sein, dass man später selbst nichts mehr davon weiß^^
Und je mehr es auf Weihnachten zu geht, umso geheimnisvoller verhält man sich. Es wird heimlich gebastelt, gekauft, eingepackt und versteckt. Es weiß von euch ja ganz sicher niemand, wo eure Eltern die Geschenke „versteckt“ haben^^
Tja, und heimlich still und leise einzukaufen ist ja kein Problem … aber die Sachen ins Haus kriegen … Das erfordert oft schon organisatorische Höchstleistungen.
Dann geht es weiter mit dem Essen. „Geheimrezept“ sagt Oma, wenn man sie nach dem Rezept zur Ente fragt. Oder die eine Sorte Plätzchen, die es nur bei Oma gibt … Da ist noch eine geheime Zutat drin.
Zur Heimlichkeit gehören selbstverständlich verschlossene Türen! Das fängt beim Adventskalender schon an. Da gibt es gleich 24 Türen. Es ist halt die Spannung, des Verborgenen, die vor allem Kinder fesselt … aber auch Erwachsene. Natürlich wissen die Kinder schnell, dass im Adventskalender jeden Tag ein Stück Schokolade hinter dem Türchen steckt. Aber wie sieht es aus? Welche Form hat es? Ist es ein Stern, ein Schlitten? Oder ist es ein Schneemann? Man weiß es nicht … da muss man schon auf den Moment warten, wo ein Türchen geöffnet wird.
Und dann gibt es noch die Tür zur Weihnachtsstube. Die hat natürlich verschlossen zu sein! Also so vom Abend des 23. Dezember bis zur Bescherung. Das Schlüsselloch gehört von innen zugehängt oder so. In der Zeit kann das Christkind oder der Weihnachtsmann dann die Geschenke verteilen … natürlich heimlich.
Und dann kommt Heiligabend! Allein der Ausdruck „heilige Nacht“ enthält schon die Vorstellung des Geheimnisvollen, Unaussprechlichen …. oder gar des Paranormalen.
Ab dem Zeitpunkt der Bescherung verpufft dann die Heimlichkeit … und verwandelt sich in einen riesigen Haufen Geschenkpapier.

Herrnhuter Stern

Der Herrnhuter Stern ist ein leuchtendes Symbol der Advents- und Weihnachtszeit mit tiefem christlichem Ursprung und interessanter kultureller Geschichte. Er steht für Licht, Hoffnung und die Ankunft Christi – und ist zugleich eines der ältesten bekannten Weihnachtssterne-Modelle. Man findet ihn oft aim Fenster oder an Deckenleuchten usw. Ganz egal ob nun gekauft oder selbstgebastelt.
Der Herrnhuter Stern entstand um 1830 in Herrnhut (Sachsen), in einer Internatsschule der Herrnhuter Brüdergemeine. Das war eine evangelische Freikirche mit Wurzeln in der böhmisch-mährischen Reformation. Dort entwickelte ein Erzieher namens P. Friedrich Schneider den typischen Stern mit 25 Zacken … und die Schüler durften den geometrische Stern im Mathematikunterricht basteln, woraus dann eine schöne Tradition wurde.
Damals wurde stets mit Papier gebastelt. In der klassischen Form hat der Herrnhuter Weihnachtsstern 17 vierzackige und 8 dreizackige Spitzen in den Farben rot und weiß. Mittlerweile gibt es ihn aus Kunststoff und in allen möglichen Farben. Oft auch mit integrierter Beleuchtung.
Der Stern war aber nicht nur Dekoration, sondern auch ein Symbol für Jesus Christus als „Licht der Welt“. Der Herrnhuter Stern erinnert an den Stern von Bethlehem und wird traditionell am 1. Advent aufgehängt und bleibt bis zum 6. Januar hängen.
Heute wird der Stern von Familien, Kirchen und Gemeinden oft über dem Adventskranz oder auch einfach so an die Decke gehängt aufgehängt. Gerade in Familien ist das zusammensetzen ein traditionelles Ritual zum Beginn des Advents.
Der Herrnhuter Stern gilt als einer der ursprünglichsten Weihnachtssterne – im Gegensatz zu den modernen Dekosternen. Auch ich hatte mal so einen Stern, aber dem ist im Laufe der Zeit ein Zacken aus der Krone geflogen … dann noch einer … und noch einer …
Mindestens ein Herrnhuter Stern sollte in jedem Haushalt sein, darum werd ich demnächst vielleicht so ein Teil basteln.

Hexenhäuschen

Hexenhäuschen sind zur Weihnachtszeit eine beliebte Tradition, vor allem in Deutschland. Sie sind eng mit dem Märchen "Hänsel und Gretel" der Brüder Grimm verbunden und symbolisieren das verlockende, süße Haus, das die Kinder in der Geschichte finden. Jetzt kann man sich ein fertiges Hexenhaus beim Konditor kaufen, dass dann aus Schokolade ist oder – und das find ich der Sache gerechter – aus Lebkuchen. In vielen Familien ist es aber Tradition, ein Hexenhaus selbst zu backen – bzw. zu basteln. Denn es gibt ja lustige Bausätze zu kaufen. Da ist dann alles bei. Das Grundhäuschen aus Lebkuchen, Märchenfiguren aus Kunststoff oder Zucker .. und ein paar Süßigkeiten zum drauf kleben. Das ist natürlich Kinderleicht – im Gegensatz zu einem selbstgebackenen Knusperhaus. Ich z.B. habe extra Ausstechformen für das Hexenhaus. Da backt man sich 1 -2 Bleche Lebkuchen, sticht die Formen aus, und dann muss man die Reste leider leider während des zusammenbasteln weg naschen. Schon dadurch ist das Bauen und Dekorieren eines Hexenhauses ist ein tolles Spiel für die ganze Familie. Es erfordert Kreativität und etwas Geduld, aber das Ergebnis erfreut in der Regel Alt und Jung. Das liegt zum Teil am köstlichen Lebkuchen … aber natürlich auch an der aufwendigen und süßen Dekoration. Da sind der Fantasie absolut keine Grenzen gesetzt. Der Zuckerguss hat da eine Doppelfunktion. Er dient als Kleber für die Hausteile und Süßigkeiten – und natürlich für die verschneiten Akzente und Eiszapfen.
Was ihr dann an Süßigkeiten drauf klebt, das bleibt völlig euch überlassen. Ob ihr einfach Zuckerstreusel oder Zuckerperlen drüber streut, oder Stück für Stück Smarties, Gummibären, Lakritzbrezeln oder Schokoherzen verarbeitet. Es gibt in den Supermärkten mittlerweile so viele Dekor-Elemente zum Vernaschen … Da bleiben kaum Wünsche unerfüllt.
So ein Hexenhäuschen macht dann zwar viel Arbeit, aber es lohnt sich! Es sieht toll aus, duftet wirklich herrlich und es schmeckt einfach köstlich.
Hexenhäuschen zu Weihnachten haben mittlerweile schon Tradition. Märchen gehören ja irgendwie auch zu Weihnachten und tragen zur weihnachtlichen Mystik bei. Alles zusammen ist untrennbar mit der gemütlichen Weihnachtszeit verknüpft.

Hirten

Die Hirten haben irgendetwas mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, was aber genau vermag kaum noch jemand zu sagen. Die Meisten finden jedoch die Vorstellung von verarmten Landbewohnern, die sich in kalter Nacht die Füße in den Bauch stehen, sehr romantisch. Dabei spielen Hirten eine zentrale und sehr bedeutsame Rolle in der Weihnachtsgeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium des Neuen Testaments überliefert ist. Sie sind die ersten Zeugen der Geburt Jesu und somit die ersten, denen die frohe Botschaft verkündet wird!
Damals war es ja so … Während andere Menschen zu dieser Zeit wahrscheinlich in ihren Häusern schliefen, waren die Hirten draußen auf den Feldern bei ihren Herden.
Es waren schlichte Menschen – oft am Rande der Gesellschafft. „Wir hatten ja damals nix“ …
Und genau zu diesen Hirten kamen der Erzählung nach die Engel. Ein Engel kam direkt auf sie zu und verkündete seinen Text: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“
Ihr kennt den Text^^
Nach dieser wundersamen Erscheinung beschlossen die Hirten sofort, nach Bethlehem zu gehen, um das Kind zu sehen, von dem die Engel gesprochen hatten. Sie fanden Maria und Josef und das Kind in einer Krippe liegend, genau wie es ihnen angekündigt worden war.
Nachdem sie Jesus gesehen hatten, erzählten die Hirten allen anderen, was Phase war und was sie erlebt hatten. Sie kehrten dann zu ihren Herden zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten.
Jetzt machen wir nen Zeithüpfer ins Heute.
Denn auch heute noch sind Hirten ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit und der damit verbundenen Bräuche. In fast jeder Krippenszene sind die Hirten mit ihren Schafen zu finden, oft auf dem Weg zur Krippe oder davor kniend.
Dann die Krippenspiele … Oft in Kirchen und Schulen aufgeführt, sind immer Hirten bei. Manchmal auch nur um das Szenebild aufzufüllen. Die Rolle ist auch nicht immer beliebt, wie wir aus dem Film „Fröhliche Weihnachten Charly Brown“ wissen. Da bemängelte Linus: „Hirte … immer muss ich einen Hirten spielen“.
Dann gibt es auch diverse Weihnachtslieder, in denen Hirten eine große Rolle spielen. Das bekannteste Lied dürfte „Kommet ihr Hirten“ sein.
Die Geschichte der Hirten an Weihnachten erinnert uns daran, dass die Botschaft der Hoffnung und des Friedens oft an den unerwartetsten Orten und durch die einfachsten Menschen empfangen und verbreitet wird.

Honigkuchen

Honigkuchen ist zur Weihnachtszeit in Deutschland und vielen anderen Ländern eine beliebte und traditionsreiche Süßigkeit. Er gehört fest zur winterlichen Backtradition, ähnlich wie Lebkuchen oder Spekulatius, und das aus gutem Grund!
Honigkuchen ist ein Gebäck, dessen Hauptbestandteil Honig ist. Jetzt fragt euch mal, warum Kinderschokolade so heißt, wie sie heißt …. NEIN – SPAAHAASS!
Der Honig verleiht dem Honigkuchen nicht nur seinen charakteristischen süßen Geschmack, sondern auch eine besondere Textur und eine längere Haltbarkeit.
Die Farbe kommt vom Honig, der beim Backen karamellisiert. Da kommt es auch ein wenig auf die Qualität des Honigs an. Honig gab es ja schon im Mittelalter … und da schon von sehr hoher Qualität. Ich verrate euch jetzt aber mal was: Ich habe Honigkuchen gebacken … mal mit richtig hochwertigem, sauteuren Honig … und mal mit billigem Eigenmarkenhonigs. Da war kein all zu großer Unterschied im Geschmack. Ich sach nur …
Beide waren saftig und würzig, wie es sein soll. Neben Honig sind typische Gewürze wie Zimt, Nelken, Kardamom, Anis und gelegentlich Ingwer enthalten, die ihm das typische warme, weihnachtliche Aroma verleihen.
Es gibt Honigkuchen in vielen Formen: als ganze Kuchenlaibe, als kleine Rechtecke (oft mit Schokolade überzogen), als Herzen oder andere Figuren. Manchmal ist er mit Mandeln oder kandierten Früchten verziert. Beliebt ist auch relativ filigrane Verzierung mit Zuckerguss.
Während ich den Text geschrieben hab, habe ich es euch schon angemerkt … Viele fragen sich:“Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zum Lebkuchen“?
Oft werden Honigkuchen und Lebkuchen verwechselt, und tatsächlich sind sie eng verwandt.
Lebkuchen ist nämlich im Grunde eine spezielle Art von Honigkuchen. Der Hauptunterschied liegt dann meist im Anteil des Honigs und der genauen Gewürzmischung. Lebkuchen enthält in der Regel mehr Gewürze und wird traditionell mit Pottasche oder Hirschhornsalz als Backtriebmittel gelockert, was ihm seine typische Konsistenz verleiht. Honigkuchen kann ebenfalls diese Triebmittel enthalten, ist aber oft "kuchenartiger", weil saftiger in der Konsistenz.
Lange haltbar sind beide Kuchen. Muss man dann halt gut verstecken, wenn es bis Weihnachten halten soll^^
Die Kombination aus Honig und den typischen Weihnachtsgewürzen schafft einen Duft und Geschmack, der perfekt zur kalten Jahreszeit und zur gemütlichen Weihnachtsstimmung passt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Honigkuchen ein fester und köstlicher Bestandteil der deutschen Weihnachtsbäckerei ist, der mit seiner Süße, seinen Gewürzen und seiner Geschichte perfekt in die festliche Zeit passt.