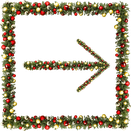Ihr Kinderlein kommet

„Ihr Kinderlein, kommet“ ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder und wird seit dem 19. Jahrhundert zur Advents- und Weihnachtszeit gesungen.
Ursprünglich war es allerdings „nur“ ein Gedicht für die Weihnachtsfeier im Schulunterricht und wurde von Christoph von Schmid (1768–1854), einem katholischen Priester, Dichter und Kinderbuchautor verfasst. Damit ein Lied daraus werden konnte, musste eine Melodie her. 1794 hat sich Johann Abraham Peter Schulz hingesetzt und eine Melodie komponiert, die ursprünglich für ein ganz anderes Lied vorgesehen war. Aber irgendwie passte das nicht so ganz und er übertrug auf seine Melodie den Text von „Ihr Kinderlein, kommet“.
Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass es manchmal etwas dauert, bis ein Lied mit dem Text zusammen passt. Und so wurde das Lied dann 1830 veröffentlicht.
Das Lied lädt Kinder und Erwachsene symbolisch zur Krippe ein, um das neugeborene Jesuskind zu bestaunen. Es beschreibt auf liebevolle, einfache Weise das Bild von der Geburt Christi: das Kind in der Krippe, die Tiere im Stall, Maria und Josef. Diese musikalische Einladung richtet sich explizit an Kinder – liebevoll, ohne Drohbotschaften und leicht verständlich.
„Ihr Kinderlein, kommet“ gehört in den deutschsprachigen Ländern zu den beliebtesten Liedern im Kindergottesdienst, in Familienfeiern, Weihnachtssingen und Krippenspielen. Und ganz nebenbei war es eines der ersten Lieder, die ich auf der Orgel spielen konnte.
Oft in Verbindung mit Krippenszenen wird das Lied auch heute noch auf traditionellen Weihnachtsfeiern in Kindergärten, Schulen und Vereinen vorgetragen – bzw. es wird auch gern von der ganzen Gemeinde gesungen. Es ist halt weihnachtlich emotional besonders wirkungsvoll.

Ilex (Stechpalme)

Der Ilex, insbesondere die Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium), spielt in der Weihnachtszeit eine bedeutende symbolische und dekorative Rolle. Ilex bleibt das ganze Jahr über grün, was ihn zu einem Symbol für Leben, Hoffnung und Beständigkeit in der dunklen Jahreszeit macht. Der christliche Aspekt darf hier natürlich auch nicht fehlen: Die stacheligen Blätter erinnern manche an die Dornenkrone Jesu - Die roten Beeren stehen symbolisch für das Blut Christi. Aber wie so oft, hatten die Heiden da schon ihre Finger im Spiel.
Die vorchristliche Kulturen verehrten Ilex als „heiliger Baum“ mit Schutzwirkung.
Früher glaubte man nämlich, dass Ilex böse Geister fernhält – ähnlich wie Mistel – aber dazu kommen wir ja später. Aber eben deshalb wurde er oft über Türen oder Fenstern angebracht.
Heute macht man das aber eher aus dekorativen Zwecken. So wird der Ilex wird häufig in Advents- und Türkränzen verwendet – oft zusammen mit Tannenzweigen, Mistel und roten Schleifen. In Weihnachtsgestecken bringt Ilex leuchtendes Grün und kontrastierende rote Beeren.
Die charakteristischen Beeren und Blätter sind auch ein beliebtes Motiv für weihnachtliche Illustrationen und Muster.
In der viktorianischen Zeit war Holly (engl. für Ilex) nahezu Pflichtdeko für Weihnachten. Viele Weihnachtslieder und -karten beziehen sich direkt auf ihn (z.B. Frank Sinatras „Mistletoe and Holly“).
So schön die Beeren und Blätter aber auch aussehen … die Sache hat einen Haken.
Die Beeren sind giftig für Menschen und Haustiere – also Vorsicht bei Kindern oder Tieren im Haus! Am besten schön hoch anbringen, dann passiert nichts und man kann sich an den magischen Anblick dieser schönen Pflanze zur Weihnachtszeit erfreuen.

In dulci jubilo

„In dulci jubilo“ ist eines der ältesten und bekanntesten Weihnachtslieder Europas, das bis ins Mittelalter zurückreicht. Es ist musikalisch und sprachlich besonders, da es lateinische und mittelhochdeutsche Sprache mischt. Man sagt, diese Mischung sei ein Zeichen von Bildung, Frömmigkeit und Poesie. Diese Sprache, bzw. Mischung nennt sich übrigens makaronisch … hat aber nichts mit den Nudeln zu tun … ich sach nur.
Ich muss zugeben, ich höre „In dulci jubilo“ eher selten. Es ist in meinen Augen – bzw. Ohren ein extrem geistliches Lied.
Es fand im Laufe der Jahrhunderte in vielen Gesangbüchern der katholischen und später auch protestantischen Kirchen seinen (berechtigten) Platz.
Die Entstehungsgeschichte ist etwas … na sagen wir mal … kurios bis seltsam. Ich möchte da ehrlich gesagt Bewusstsein erweiternde Substanzen nicht ausschließen ...
Vermutlich um 1328 durch den deutschen Mystiker und Dominikanermönch Heinrich Seuse (auch: Suso). Er soll das Lied laut Legende nach einer himmlischen Vision mit singenden Engeln selbst getanzt haben … Ah ja^^
Verglichen mit Heute, war das damals wohl ein Megahit, den jeder im Laufe der Zeit mal gecovert haben muss. Die Melodie wurde seit dem 14. Jahrhundert in vielen Varianten überliefert. Berühmte Komponisten haben da Hand angelegt und das Musikstück zu dem entwickelt, wie wir es kennen.
Johann Sebastian Bach hat gleich zwei Orgelchoräle (BWV 608 und BWV 729) daraus arrangiert. Dietrich Buxtehude hat was dazugetan … und Robert Lucas Pearsall bastelte 1837 daraus eine englische Chorversion kreiert, die im angelsächsischen Raum sehr verbreitet ist.
Interessanterweise ist „In dulci jubilo“ besonders in England, Skandinavien und Deutschland bekannt … also den Landstrichen der alten Germanen und Kelten.
Häufig wird es bei klassischen Weihnachtskonzerten, Choraufführungen oder Krippenspielen gespielt. In der Regel in Chorsätzen, Orgelmusik oder festlicher Instrumentierung.
Es gehört zu Weihnachten wie das Salz in der Suppe! Eine Christmette ohne „In dulci jubilo“ gehört eigentlich verboten. Diese Komposition verleiht dem Weihnachtsfest eine extrem feierliche Note.

Ingwer

Ingwer hat in der Weihnachtszeit eine lange Tradition, besonders in der Küche und Heilkunde. Ingwer wurde bereits im Mittelalter als kostbares Gewürz nach Europa importiert. In historischen Rezepten galt Ingwer deshalb als Zeichen für Reichtum und Exotik, da er importiert werden musste. Aber zur Weihnachtszeit waren teure Gewürze wie Ingwer, Zimt, Nelken und Muskat sehr beliebt. Und sind wir mal ehrlich … Zum Weihnachtsfest kann man es ja mal krachen lassen.
Fangen wir mit der Weihnachtsbäckerei an. In den klassischen Lebkuchenteig gehört neben vielen anderen Zutaten eben Ingwer. Dieser Teig ist quasi eine Basismasse für viele andere Rezepte. Zum Beispiel für Pfefferkuchen, Ingwerplätzchen oder Gingerbread. Das „Ingwerbrot finden wir in England und den USA. Dort gibt es die köstlichen Gingerbread-Men oder das Gingerbread House, das so ähnlich aussieht, wie unser Hexen- oder Knusperhäuschen. Auch mit viel Zuckerguss, aber ohne Hexe. Das Häuschen soll Weihnachtsheimeligkeit symbolisieren.
Ingwer darf aber auch in diversen Heißgetränken nicht fehlen. Z.B. Ingwertee mit Honig, Zitrone und Zimt – ein beliebtes Wintergetränk. Auch Glühwein oder Punsch enthalten oft eine Note von Ingwer für Wärme und Schärfe.
Ingwer ist so eine kleine Geheimwaffe und sorgt für das Wohl in Leib und Seele. Es stärkt das Immunsystem und wirkt antibakteriell. Einfach ideal in der Erkältungssaison, in der ja die meisten Weihnachtsmärkte statt finden. Und wenn es da bitterkalt ist, dann her mit dem Ingwer. Denn das Zeug fördert die Durchblutung, weshalb Ingwer als „wärmendes Gewürz“ gilt. Na ja …. und nach dem fetten Weihnachtsessen hilft es auch den Magen zu beruhigen – denn es ist Verdauungsfördernd.
Ingwer ist auch in der Weihnachtszeit ein wunderbares Teufelszeug! Und wenn ihr mal in Schweden oder Norwegen Weihnachten verbringt, dann lasst euch die Pepparkakor schmecken. Das sind dünne Ingwerkekse und ein typisches Weihnachtsgebäck dort.