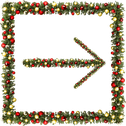Kamin

Ohne Kamin keine Geschenke – Wie soll denn der Weihnachtsmann sonst ins Haus kommen? Thema erledigt. Nein Quatsch^^ Es ist eine Weihnachtslegende, dass der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und den Rentieren auf dem Dach des Hauses landet, ne Cola trinkt und dann durch den Kamin in die Bude kommt und die Geschenke bringt. Diese Legende kommt hauptsächlich aus den USA (welch Überraschung). Aber auch in England soll der Weihnachtsmann durch den Schornstein plumpsen. Bitte nicht falsch verstehen – Ich mag diese Szene. Ich hab ja genug Filme, wo es genau so beschrieben ist. Außerdem trinke ich gerne Cola …
Das Problem ist aber: Viele Menschen haben gar keinen Kamin … und die Geschenke liegen trotzdem unterm Baum!
Der Gedanke, dass der Weihnachtsmann durch so eine Gliederheizkörper schlurft … oder gar durch die Fußbodenheizung rieselt ist aber schon lustig.
Aber kommen wir wieder zu den Leuten, die einen Kamin haben. Oft ist der weihnachtlich geschmückte Kamin mit ein zentraler Teil der Weihnachtsstube. Der Kamin wird gern mit Tannenzweigen, Girlanden und natürlich den berühmten Weihnachtsstrümpfen dekoriert – mit der Hoffnung, dass der Weihnachtsmann noch ein paar Kleinigkeiten in die Strümpfe steckt. Je nach Gebrauch stellt man auch Kerzen auf den Kaminsims. Wenn das Feuer aber täglich brennt, sollte man evtl. von Kerzen absehen. Nicht, dass die noch schmelzen. So ein Kamin schafft ja eine wunderschöne heimelige Atmosphäre. Das Licht … der Duft … herrlich – aber auch nicht ungefährlich.
Bei der Dekoration eines Kamins ist es nämlich wichtig, auf die nötige Sicherheit zu achten! Brennbare Materialien sollten jetzt nicht zu nahe ans Feuer platziert werden. Viele Artikel wie z.B. Deko-Weihnachtsstrümpfe sind aus Kunststofffasern. Sowas also am besten weg lassen. Aber eine offene Feuerstelle sollte man ja eh nicht aus den Augen lassen, wie jeder weiß.
Erst recht nicht, wenn man einen dicken Holzklotz anfeuert. Das geschieht nämlich in einigen Kulturen. Mal so als Beispiel: In Schweden gibt es den Julklotz – da nimmt man einen Holzscheit (meist aus Eiche oder Esche), der wird verbrannt … und die Asche davon soll dann Glück bringen.
So ein Kamin ist schon eine feine Sache. Neben der wohligen Wärme verteilt das Feuer ein schönes Licht und einen wunderbaren Duft … wenn man das richtige Holz nimmt. Festlich geschmückt ist der Kamin ein schöner Zusatz in der Weihnachtsstube und sorgt für eine traumhafte Atmosphäre.

Kandierte Früchte

Kandierte Früchte sind nicht nur zu Weihnachten eine beliebte Süßigkeit und Zutat. Aber besonders Orangeat und Zitronat finden oft ihre Verwendung in der Weihnachtsbäckerei. Man findet es oft in Weihnachtsgebäck wie Stollen, Lebkuchen, Früchtekuchen oder auch pur als Nascherei für zwischendurch. Als Naschwerk eignen sich auch kandierte Ananas, Kirschen oder Pflaumen.
Kandierte Früchte gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Damals hat man so die Früchte konserviert, die man kurz zuvor geerntet hat. Kirschen z.B. hat ja schon der Römer Lucullus so 74 v.Chr. Nach Deutschland gebracht. Die gab es im Sommer und die Pflaumen im Herbst … und gerade bei Herbstfrüchten war es für den Winter praktisch, einen Vorrat anzulegen. Und die Obstbäume dazu hatte ja früher fast jeder mit nem grünen Daumen vor dem Haus. So erklärt sich auch der Sprung in die Weihnachtszeit. In vielen Kulturen gehören Kandierte Früchte in die Weihnachtszeit. Denn auch, wenn man recht leicht an die Früchte kam … sie mussten ja noch konserviert werden um zu einem süßen Luxusgut zu werden.
Der Vorgang hat sich seit der ganzen Zeit nicht viel verändert. Kandieren ist ein simpler Prozess, bei dem man die Früchte in einer Zuckerlösung kocht. Dadurch verlieren die Früchte Wasser und nehmen den Zucker auf. Sie werden damit haltbar gemacht und erhalten durch die Konservierung eine glasierte, leicht glänzende Textur.
Kleiner Tipp für die Weihnachtsbäckerei: Besorgt euch lieber zu viel, als zu wenig! Wenn bei Orangeat oder Zitronat 1 Gramm fehlt, macht das nichts. Ärgerlich wird es bei Torten, wo man dann evtl. kandierte Kirschen verwendet. Manchmal braucht man da 12 – 16 Kirschen … und ausgerechnet dann fehlen ein bis zwei. Es passiert, dass so manche kandierte Frucht in der Weihnachtsbäckerei auf völlig unerklärlicher Weise einfach so verschwindet … Ich sach nur.

Kardamom

Die Herren verbeugen sich – die Damen machen nen Hofknicks. Denn Kardamom wird oft als die Königin der Gewürze bezeichnet. Das edle Gewürz kommt ursprünglich aus Indien und wird in vielen asiatischen und orientalischen Gerichten verwendet. Auch hier in Europa ist Kardamom sehr beliebt – insbesondere in der Weihnachtsbäckerei. Da wird dann so köstliches Gebäck wie Spekulatius, Lebkuchen und auch anderen Plätzchen verfeinert. Es hat ein süßlich-scharfes Aroma und kann auch bei Glühwein sowie anderen heißen Getränken eine feine Note hinterlassen. Jetzt kann man Kardamom gemahlen – oder als ganze Kapsel verwenden. Die Kapseln sollen dabei wesentlich aromatischer sein, weil man sie frisch aufbricht.
Wie die meisten Gewürze hat auch Kardamom einen wohltuenden Nebeneffekt. Das edle Gewürz soll verdauungsfördernd wirken und lindert Erkältungsbeschwerden.

Karpfen

Den Karpfen kennt man ja eigentlich eher als Silvester-Speise. Es gibt aber genug Haushalte, wo der Karpfen auch gern an Heiligabend als leichtes Weihnachtsessen serviert wird. Ich bevorzuge ja Kartoffelsalat – allein schon, weil da einfach weniger Gräten drin sind^^ Der Karpfen ist ein Glitschfisch mit komplexem Grätenapparat, das viel Arbeit beim Essen macht.
Seine Tradition als Weihnachtsessen hat der Karpfen aus der christlichen Fastenzeit erhalten. Ihr wisst ja … der Advent war früher Fastenzeit und dann gab es an Heiligabend als Ende der Fastenzeit eben den Fisch auf den Tisch. Und auch später war Fleisch im Advent verpönt. Da nahm man den Karpfen aus den heimischen Gewässern und servierte ihn auf der Weihnachtstafel.
Heute wird Fisch ja meist direkt geschlachtet, filetiert und dann verkauft. Früher hat man den Karpfen aber oft noch lebend gekauft und dann zu Hause zerlegt.
Lebendverkauf gibt es heute auch noch … was bei Tierschutzorganisationen nicht besonders gut ankommt. Erst recht, weil es in der Vorweihnachtszeit eher aus traditionellen Gründen Gefallen findet. Dabei hat es natürlich auch mit Qualität und Frische zu tun. Und so manche Tradition ist als Filet nicht so wirklich möglich. So gibt es regionale Bräuche die aber dann eher zu Silvester angewendet werden. Da gibt es z.B. das Aufbewahren einer Karpfenschuppe für Glück und Wohlstand oder das Vergraben von Karpfengräten im Garten, um eine reiche Ernte zu sichern. Vergrabt die Gräten aber tief, sonst hat die Katze eine schöne Bescherung.

Karten

Weihnachtskarten sind eine Tradition, bei der schöne Karten mit fröhlichen oder feierlichen Grüßen zu Weihnachten verschickt werden. Sie haben eine nicht ganz so lange Geschichte wie andere Bräuche, aber sie sind (auch heute noch) in vielen Kulturen ein beliebter Weg, um anderen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
Die ersten Weihnachtskarten gab es so Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Engländer Sir Henry Cole gilt als einer der ersten Sender einer gedruckten Weihnachtskarte. Das war 1843 und er tat das, um sich das Schreiben persönlicher Briefe zu erleichtern. Heute würde er das sicher auch über die sozialen Medien tun ...
Damals war das aber eine tolle neue Sache und die Karten wurden weltweit sehr schnell populär.
Es war ja auch ein leichter Weg, Familie und Freunde in weiter Ferne zu erreichen. Damals gab es ja auch noch Postkutschen … daher ist es schon irgendwie witzig, dass es früher trotzdem schneller ging^^
Weihnachtskarten gibt es heute in allen möglichen Ausfertigungen. Da ist für jeden was dabei. Angefangen von den Motiven, die da gern traditionell, feierlich, fröhlich oder auch albern mit lustigen Sprüchen angehaucht sind, bis hin zu musikalischen Karten, die beim Aufklappen „Last Christmas“ spielen.
Und dann gibt es die Weihnachtskarten mit einer ganz persönlichen Note. Entweder selbst gestaltet – sei es gezeichnet oder gebastelt – oder mit eigenen Fotos bedruckte Karten, wie sie in den USA eine (wenn auch wohl manchmal nervige) Tradition ist.
Aber egal für welche Form und welches Motiv man sich entscheidet … so eine Weihnachtskarte ist eine Möglichkeit, seine Wertschätzung auszudrücken.
Viele Menschen sammeln die Weihnachtskarten sogar als schöne Erinnerung über Jahre … wenn nicht sogar Jahrzehnte.
Heute geht das natürlich einfacher … da lässt man die Weihnachtsgrüße per Mail oder Posting einfach in der Timeline und gut ist. Aber mal unter uns … eine selbstgeschriebene Weihnachtskarte, die uns vom Postboten an Heiligabend übergeben wird, ist schon etwas ganz Besonderes und setzt so manchem Weihnachtsfest noch ein kleines Krönchen auf.

Kartoffelsalat

Kartoffelsalat! Jahrzehnte lang mein Höhepunkt an Heiligabend! Pfeif auf Geschenke, pfeif auf die Torte … Aber Kartoffelsalat muss!
Er ist in Deutschland ein … wenn nicht sogar DAS traditionelle Gericht an Heiligabend. Ich möchte das echt nicht bewehrten, denn es gibt ja soo viele tolle Gerichte. Darum hab ich meine Gewohnheiten auch etwas geändert. So gibt es mittlerweile meinen Kartoffelsalat ein paar Tage vorher – denn ganz verzichten is nicht! Und Heiligabend gibt es Essen bei Schwiegermutter. Nur eben kein Kartoffelsalat.
Aber für viele Familien ist er halt ein unverzichtbarer Bestandteil des Weihnachtsessens. Oft wird er mit Würstchen serviert, was ein einfaches und schnell zubereitetes Gericht darstellt. Ich hab das früher z.B. regelrecht zelebriert. Als Frühaufsteher war ich Heiligabend oft schon um fünf oder sechs wach. Kaffee aufgesetzt und dann ran an den Salat. Wenn meine Eltern dann aufgestanden sind, war der Salat fertig und wir konnten frühstücken. Schließlich gab es im Laufe des Tages noch genug zu tun.
Das war irgendwie immer schon so. Und früher war ja da die Fastenzeit im Advent. Da war ein einfacher Kartoffelsalat auch schon eine sehr beliebte Speise.
Bei mir wird der Kartoffelsalat klassisch norddeutsch mit Mayonnaise zubereitet. Ich kenne und mag aber auch die süddeutsche Variante auf Essig-Öl-Brühe-Basis.
Bei beiden Möglichkeiten werden aber so oder so festkochende Kartoffeln verwendet. Auf die restlichen Zutaten möchte ich hier verzichten, denn es gibt ja hunderte verschiedene Rezepte … soll man gar nicht glauben … und jeder hat das beste Rezept überhaupt. Aber auf zwei Zutaten möchte ich dennoch hinweisen: Zeit und Liebe! Manche kochen die Kartoffeln schon am Vortag – dann die Zubereitung später noch schneller.
Für viele Familien ist der Kartoffelsalat an Heiligabend nicht nur ein Gericht, sondern ein Stück gelebte Tradition, das Erinnerungen weckt und Stabilität in der Weihnachtszeit bietet.

Kerzen

Advent, Advent, ein Kerzlein brennt. Wer kennt es nicht.
Kerzen sind seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil menschlicher Kultur und haben sich von einer reinen Lichtquelle zu einem vielseitigen Element der Dekoration und Atmosphäre entwickelt. Ob für festliche Anlässe, gemütliche Abende oder als stilvolles Wohnaccessoire – die Welt der Kerzen ist vielfältig .. und alt.
Kerzen gibt es, grob gepeilt, seit mindestens 5000 Jahren. Erste Leuchtmittel – nennen wir es mal so – wurden bereits im alten Ägypten und im vorderen Orient verwendet. Da tauchte man Dochte in geschmolzenem Tierfett oder Öl.
Die Kerzenherstellung wurde im Mittelalter ein wenig weiter entwickelt. In Adelshäusern und besonders in kirchlichen Einrichtungen kamen Bienenwachskerzen zum Einsatz. Und Bienenwachs war teuer! Aber auch die ärmere Bevölkerung hatte Kerzen. Da ersetzte Rinderfett oder Hammeltalg das Bienenwachs. Da verbrachte man die Herbstabende oft damit, Kerzen zu ziehen. Da nahm man den Docht und tauchte ihn so oft ein, bis die Kerze dick genug war. Da konnte es schon mal sein, dass man so 20 bis 30 mal eintauchen musste ...
Man musste bis zum 19. Jahrhundert warten, bis das Ganze allgemein etwas günstiger wurde. Man hatte Paraffin und Stearin entdeckt, was die Kerzen für die breite Bevölkerung erschwinglich machte. Lustiger Nebeneffekt: Durch die Entdeckung der beiden Materialien war die industrielle Massenproduktion möglich und man konnte Kerzen gießen.
Doch wie funktioniert so eine Kerze? Man braucht ja nur zwei Sachen – brennbares Material, also Wachs … und einen gescheiten Docht. Bei beidem gibt es Unterschiede, die Brenndauer, Abbrennverhalten und Duft beeinflussen.
Der Docht saugt das flüssige Wachs an und transportiert es zur Flamme, wo es verbrennt und Licht sowie Wärme abgibt. Damit das so klappt, sind die Dochte vorab in Wachs getränkt. Das war´s schon.
Jetzt gibt es ja eine unendliche Auswahl an Kerzen. Von Form und Größe über Material bis hin zum Preis hat man die freie Auswahl.
Fangen wir an mit den Stabkerzen. Ob nun als Tafelkerzen, Baumkerzen für den Tannenbaum (ja, die gibt es noch), Kerzen für den Adventskranz usw.
Von der Sorte gibt es noch ganz spezielle Kerzen, die extra für Kronleuchter produziert werden … aber mittlerweile eher selten entzündet werden.
Es folgen die Stumpenkerzen. Dicke, zylindrische Kerzen, die eine lange Brenndauer haben und oft als Dekorationselement dienen. Allerdings werden sie in Kirchen gern zur Messe entzündet.
Bei vielen Menschen beliebt: Die Duftkerze. Die sind dann mit ätherischen Ölen oder Duftstoffen angereichert und verbreiten je nach Aroma den dementsprechenden Duft.
Nicht zu vergessen – die Teelichter. Diese kleinen Kerzen in Aluminium-Schälchen kennt sicher jeder. Es gibt ja auch einen großen Markt an Windlichter oder sonstigen Leuchtartikeln – besonders zur Weihnachtszeit. Ich muss gestehen … ich hab keine Ahnung, wie viele Teelichtbehälter ich habe! Jetzt sind diese Alu-Schälchen nicht besonders Umweltfreundlich. Da ich das weiß, bewahre ich die Teile auf und gieße aus Kerzenresten einfach neue Teelichter. So einfach ist das. Zudem ist Kerzen gießen ein schönes Hobby an dunklen Abenden.
Kerzen sind einfach was herrliches – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Sie sind mehr als nur Licht- und Wärmespender. Kerzen sind ein regelrechter Seelenwärmer. Sie verleihen Dekorationen einen gewissen Ausdruck von Gemütlichkeit. In der richtigen Kombination kann man so eine harmonische Weihnachtsatmosphäre schaffen, die keine Wünsche mehr offen lässt.

Kirche

Der Besuch einer Kirche ist für viele Christen ein wichtiger Bestandteil zum Weihnachtsfest. An Heiligabend, dem ersten oder zweiten Weihnachtstag … es finden soo viele Gottesdienste statt, bei denen traditionell Weihnachtslieder gesungen, Krippenspiele aufgeführt und natürlich die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Überall wird die Geburt Jesu gefeiert.
Für viele Christen ist der Kirchenbesuch ja ein wichtiger Ausdruck ihres Glaubens und der Gottesdienst bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Christen Weihnachten zu feiern und den Glauben zu teilen.
Der Besuch einer Kirche ist bei vielen Familien Tradition zu Weihnachten … und das NUR zu Weihnachten! Ok, kann ja jeder machen, wie er will, aber oft ist es nur ein „sehen und gesehen werden“ und hat mit dem christlichen Gedanken eher weniger zu tun. Und dann gibt es noch die Kirchenbesucher, die einfach nur wegen der Atmosphäre die Mitternachtsmesse besuchen. Das kann ich durchaus verstehen. Je nach Größe der Kirche stehen da gleich mehrere Tannenbäume, reich geschmückt. Oft auch eine sehr schöne Krippe … alles meist ein zwei Nummern größer als das alte Vogelhäuschen, das nun zu Hause als Krippe dient. Dazu kommt der Klang der Orgel und das gemeinschaftliche Singen … Hach – Kirche und Weihnachten kann was.

Kling Glöckchen klingelingeling

"Kling, Glöckchen, klingelingeling" ist ein bekanntes deutsches Weihnachtslied, das gern in der Weihnachtszeit gesungen wird. Der ursprüngliche Text stammt von Karl Enslin und wurde im 19. Jahrhundert verfasst. Die heute bekannte Melodie wird traditionell einer Volksweise zugeschrieben, obwohl es auch andere Vertonungen des Textes gibt. Eigentlich handelt das Lied von einem freundlichen Bitten um Einlass ins Haus. Meiner Meinung nach bittet da das Christkind um Einlass um die Geschenke zu überbringen. Ich schließe das anhand der Sprache aus dem Text.
Mittlerweile gibt es aber Adaptionen an das Lied, die manchmal den alten Text verhohnepiepeln.
Die ursprüngliche Version von "Kling, Glöckchen, klingelingeling" ist in vielen deutschsprachigen Regionen beliebt und gehört zum Standardrepertoire bei Weihnachtsfeiern in Schulen und Kindergärten.

Knecht Ruprecht

Knecht Ruprecht ist der Begleiter des heiligen Nikolaus. Während Nikolaus sich um die braven Kinder kümmert und sie beschenkt, ist Knecht Ruprecht eher für die Unartigen zuständig. Er droht da gern mal mit der Rute, die er manchmal auch einsetzt …. „Irgendwann werd ich dir in die Fresse haun … wenn du zu frech wirst“. Ach nee … das war ja Klaus Kinski^^
Jedenfalls gilt Knecht Ruprecht als Gehilfe vom Nikolaus und ermahnt die Kinder, die nicht brav waren. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass es nicht reicht, ab dem 4. Dezember mal brav zu sein … Ich sach nur^^
Das kommt in dem Zeitraum der nächsten 48 Stunden nämlich nicht mehr in das goldene Buch.
Bei der Bestrafung der unartigen Kinder streiten sich die Geister. Da wäre zum einen die Sache mit der Rute. Mal droht der Nikolaus, mal Knecht Ruprecht. Vielleicht pikt sich der Nikolaus aber auch nur seine speziellen „Lieblinge“ heraus und lässt dem Ruprecht den Rest. Ja und dann ist da noch der Sack, in dem Knecht Ruprecht die ganz bösen Kinder steckt und mit nimmt. Diese Rolle schreibe ich allerdings eher dem Krampus zu, der besonders im Süden Deutschlands sein Unwesen treibt. Aber der kommt ja auch gleich noch … weiter unten auf dieser Seite.
Knecht Ruprecht trägt je nach Region verschiedene Namen. Mal wird er als Knecht Nikolaus bezeichnet, mal als Nickel oder Pelznickl. Auch die Namen Hans Muff oder Hans Trapp schwirren da im Raum.
Von seiner Erscheinung wirkt Knecht Ruprecht wie ein alter Heide. Es wird sogar vermutet, dass Knecht Ruprecht ganz gut mit dem germanischen Gott Wodan vernetzt ist. Ich frag ihn beim nächsten mal^^
Ich muss gestehen … ich hab nicht eine Dekoration, die an Knecht Ruprecht erinnert. Aber es reicht ja auch, wenn er persönlich vorbei schaut …
Viele Eltern „missbrauchen“ Ruprecht, indem man den Kindern mit ihm droht, wenn sie nicht brav sind. Kann funktionieren …. bei mir hat es nicht … ach lassen wir das.
Man muss es so sagen: Knecht Ruprecht ist eine Gestalt, auf die man zur Weihnachtszeit verzichten kann. Es sei denn, er ist nötig um die „Patienten“ vom Nikolaus zu „retten“. Kleiner Tipp: Ruprecht hat oft für die braven Kinder kleine Gaben in Form von Nüssen in seiner Manteltasche. Aber Vorsicht – nicht rein greifen! Sonst werden aus den Nüssen Kohlen! Aber fragt mich nicht, woher ich das weiß ...

Knut

Knut aus deutscher Sicht: Bis ca 20:00 Uhr ist an Heiligabend die Bescherung gelaufen. Ab da sprudelt gefühlt alle 10 Minuten eine Werbung eines schwedischen Möbelhauses über den Bildschirm, wo wie bescheuert Tannenbäume aus den Fenstern geworfen werden. Fertig
So einfach ist das natürlich nicht!
In Schweden sagt man nämlich "Tjugondag Knut" und meint damit den 13. Januar. Tjugon heißt soviel wie 20 - Und am 13. Januar ist das Ende der 20-tägigen Weihnachtszeit in Schweden. Also etwas länger als bei uns, wo ja für die meisten am 06. Januar Feierabend ist.
Schuld daran trägt der dänische König Knut IV.
Er ist auch als heiliger Knut bekannt und lebte im 11. Jahrhundert.
Es gibt verschiedene Erzählungen, warum der 13. Januar das Ende der Weihnachtszeit bedeutet. So erzählt man sich, dass Knut IV. die Weihnachtszeit besiegelt hat, um seine Frömmigkeit zu zeigen. Eine andere Version erzählt davon, dass der Dreikönigstag (6. Januar) zwar das Ende der Weihnachtszeit wäre, aber da man grad so schön dabei war, hat man die Zeit bis zum 20. Januar verlängert und einfach weiter gefeiert. Klingt für mich ehrlich gesagt logischer ...
Die Bräuche beim Knutfest sind mehr oder weniger eine Kombination und greift nahtlos ineinander. An erster Stelle steht das Abschmücken des Weihnachtsbaumes und das Ausplündern … damit sind dann die Süßigkeiten gemeint. In Schweden nennt man das dann "Julgransplundring". Der Baum wird aus der Bude entfernt (nicht immer durch das Fenster!) und die Süßigkeiten teilweise gegessen und teilweise aufbewahrt … Denn in manchen Regionen ziehen Kinder als „Knutgubbar“ verkleidet von Haus zu Haus (meist ländlich) und betteln um Süßigkeiten.
Danach werden auf (meist öffentlichen) Plätzen die Weihnachtsbäume verbrannt.
Damit ist das Thema Weihnachten in Schweden erst einmal erledigt und man freut sich auf die nächste Weihnachtszeit.

Komet

Der Stern von Bethlehem spielt in der Weihnachtsgeschichte ja eine sichtbar wichtige Rolle: „Sie hüllten sich in seltsame Gewänder und folgten einem Stern“ … Die Rede ist natürlich von den heiligen drei Königen. Wem oder was sie da gefolgt sind, weiß man nicht so ganz genau. Eine Theorie besagt, dass es sich um einen Kometen handelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es sich dabei um eine besondere Konstellation von Planeten oder eine Supernova gehandelt haben könnte.
Oft wird der Halleysche Komet als Stern von Bethlehem bezeichnet. Das Problem: Der Halleysche Komet schwirrte mit seinem Schweif so um das Jahr 12 v. Chr. Durch die Gegend. Passt jetzt nicht so ganz mit Jesu Geburt ...
Zuletzt war der Komet für uns 1986 sichtbar. Hmm … Das muss so ein Gottesding sein … denn mit 1986 verbinde ich eigentlich die Hand Gottes (Maradonna).
Jedenfalls kehrt der Halleysche Komet alle 75 bis 76 Jahre zur Erde zurück – bzw. daran vorbei, hoffe ich. Das hängt ja auch alles vom Verkehr da oben ab^^
Bis zum nächsten Termin müssen wir noch etwas warten. Die Vorhersagen haben den 28. Juli 2061 ergeben. Nun – wir werden es sehen … oder auch nicht. Is ja doch noch etwas hin.
Vielleicht war aber auch der Komet Catalina der Weihnachtsstern. Der flog zuletzt im Dezember 2015 hier vorbei und war auch nur mit dem Fernrohr zu sehen. Ein weiterer Komet, der in Frage käme war der Komet Leonard. Auch er erreichte nur die Nähe unserer Erde.
Vielleicht war es aber auch ganz was anderes …
Das ist jetzt der Moment, wo die Musik von „Raumschiff Enterprise“ Oder „Akte X“ erklingen sollte …
Es gibt jedenfalls keine belegten Fakten, die genau erklären, was die heiligen drei Könige da über dem Stall von Bethlehem gesehen haben – bzw. gesehen haben wollen.
So bleibt uns nur der romantische Gedanke vom Weihnachtsstern – aber das ist ja auch schön.

Kommet, ihr Hirten

Vom Komet zu „Kommet, ihr Hirten“ … was ne Überleitung …
"Kommet, ihr Hirten" ist ein bekanntes Weihnachtslied und kommt ursprünglich aus Böhmen – um genauer zu sein – aus dem altböhmischen Olmütz. Dort heißt es "Nesem vám noviny" und erzählt von der Verkündigung der Geburt Jesu durch Engel an die Hirten und deren Besuch der Krippe in Bethlehem.
Das Lied hat schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Die Melodie stammt aus der Zeit um 1605.
Der deutsche Komponist und Kapellmeister dachte sich: „Ich versteh kein Wort“ … und schrieb 1870 einfach einen deutschen Text dazu und nannte das „neue“ Werk „Die Engel und die Hirten“.
Der Text ist bis heute gleich geblieben – lediglich der Titel wurde angepasst.
„Kommet, ihr Hirten“ ist in der katholischen wie auch der evangelischen Kirche präsent und ist ein oft gesungenes Lied in Gottesdiensten, wie auch bei Weihnachtsfeiern in Schulen und Kindergärten.
Es gibt auch eine niederländische und englische Version von „Kommet, ihr Hirten“.
Aber egal, welche Sprache – es ist einfach ein schönes Weihnachtslied.

Koriander

Es wird wieder würzig! Koriander ist ein beliebtes Gewürz in der Weihnachtszeit – besonders in der Weihnachtsbäckerei. Das Gewürz kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und dem nahen Osten. Schon die alten Römer und Griechen hatten Koriander in ihren Küchen. So könnt ihr euch sicher denken, dass es sich hier um eines der ältesten Gewürze handelt.
Die Koriandersamen werden gern in herzhaften Gerichten verwurstet .. etwa in Curry oder Salaten, weil sie einen so würzig-süßen Geschmack haben.
Wir rösten die Samen, mahlen sie und gehen damit in die Weihnachtsbäckerei. Gemahlen lässt es sich dann ja doch besser verarbeiten.
Koriander wird gern für Leckereien wie Lebkuchen, Printen und anderen Weihnachtsbackwerke mit einer würzigen Note verwendet. Das gibt dem Ganzen einen nussig-würzigen Geschmack.
Ich empfehle frisch gemahlenen Koriander. Das hat vom Aroma her richtig Power und entfaltet sich dann hervorragend.
Wie bei den meisten Kräutern und Gewürzen hat auch Koriander eine heilende Wirkung. Die Samen können bei Verdauungsbeschwerden helfen und können sogar Krämpfe lösen.
Es ist also ein perfektes Weihnachtsgewürz! Erst Gebäck und andere Speisen verfeinern … dann hilft es, das Essen zu verdauen, und wenn man auf der Weihnachtsparty zu viel getanzt hat, hilft es auch noch bei Krämpfen. Na da kann doch nichts mehr schief gehen.

Krampus

Ich hab ja schon bei Knecht Ruprecht angekündigt, dass es da noch jemanden gibt … den Krampus! Beide sind Begleiter vom heiligen Nikolaus. Und während Knecht Ruprecht ja eher harmlos ist, ist der Krampus die Schreckensgestalt schlechthin in der Weihnachtszeit. Er taucht vor allem im Adventsbrauchtum im Alpenraum auf. Also so die Ecke Bayern, Österreich, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Südtirol und in Teilen Norditaliens.
Seinen Ursprung findet der Krampus (mal wieder) in der vorchristlichen, heidnischen Zeit. In ihm steckt so manch dämonische Gestalt aus dem alpenländischen Raum.
Der Name "Krampus" kommt vermutlich vom mittelhochdeutschen "Krampen" (Kralle) oder vom bayerischen "Krampn", was so viel heißt, wie Vertrocknet … bzw. Leblos.
Dementsprechend sieht er ja auch aus. Er war damals schon der Begleiter vom Nikolaus und hat sich um die unartigen Kinder „gekümmert“. Weil es früher einfacher war, irgend jemanden zu verkleiden, hat man das eben so durchgezogen … bis zur Inquisition … Da war der Brauch nämlich zeitweise verboten, da das Verkleiden als teuflische Gestalt als Ketzerei galt. Damals war man tatsächlich so dämlich – doch damit nicht genug: Wer sich als Krampus verkleidet hat und erwischt wurde, durfte mit der Todesstrafe rechnen! In den hintersten und abgelegensten Alpentälern gab es aber todesmutige Menschen, die diesen Brauch still und heimlich weitergeführt haben … zum Glück. Ab dem 17. Jahrhundert durfte man wieder und der Brauch hat sich wieder etabliert.
Und er kam gruseliger wieder, als je zuvor:
Er trägt einen Mantel oder Umhang aus Tierfell, eine handgeschnitzte Holzmaske, die ein furchteinflößendes dämonisches Gesicht hat. Mittlerweile gibt es zwar Masken aus Latex oder Kunststoff, aber die Masken aus Holz sind wesentlich traditioneller und werden über Generationen vererbt. Je nach Maske befinden sich oberhalb des Gesichts auch noch Hörner. Je nach Region sind das dann Ziegenbock-, Steinbock- oder Widderhörner. Der Krampus ist mit schweren Ketten behangen, die fürchterlich klirren und oft dazu große Kuhglocken. Das scheppert ordentlich und soll damit die bösen Geister vertreiben und das Kommen des Krampus´ ankündigen.
Er hat gelegentlich einen zerlumpten Sack oder eine Butte auf dem Rücken geschnallt. Die Legende erzählt, dass er da die richtig bösen Kinder rein steckt. Die Kinder, die zwar unartig – aber nicht ganz so böse waren, bekamen „nur“ die Rute oder den Rossschweif zu spüren.
In vielen Regionen in Bayern und Österreich sind die Krampusläufe auch heute noch sehr beliebt. Der Krampustag ist stets am 5. Dezember – also am Vorabend vom Nikolaustag. Da ziehen oft ganz viele Krampusse in ihren aufwendigen Kostümen und Masken und viel Getöse durch die Straßen. Das ist immer ein großes Spektakel und zieht viele Zuschauer an. Eigentlich sollen die Kinder da nur erschreckt werden. Es gibt aber oft Experten (meist Jugendliche), die es etwas übertreiben und dann auch schon mal die Rute zu spüren bekommen.
Und auch, wenn der Krampus eine echt unheimliche Figur ist, gehört er zum traditionellem Brauchtum im alpenländischen Raum. Er ist ein herausragendes Beispiel für die Verschmelzung von christlichen und heidnischen Traditionen, die in der Weihnachtszeit nicht fehlen sollte.

Krippe

Die Krippe ist im Prinzip ja eine alte Futtervorrichtung für Tiere. Man findet sie auch heute noch oft in heimischen Wäldern. Der Gedanke, dass bei der Weihnachtsgeschichte klein Jesu in genau so einer Futterkrippe gelegen hat, ist schon ein wenig verrückt. Aber die Zeiten damals waren hart – und sind wir mal ehrlich … wir hatten doch nix.
Die Weihnachtskrippe unter dem Tannenbaum ist eigentlich ein Puppenhaus, um die Weihnachtsgeschichte nach zu spielen – bzw. nach zu bilden. Es heißt zwar immer, das die Szene die Geburt Jesu Christi gezeigt wird, was aber so gar nicht stimmt. Denn die Geburt ist ja bereits gelaufen und der kleine Mann liegt bereits in der Krippe. Das ist aber auch gut so.
Die ganze Szenerie ist ja auch „nur“ ein Symbol für die Geburt Jesu im Allgemeinen und eben die Weihnachtsgeschichte drum herum, wie sie im Lukas- und Matthäusevangelium geschrieben steht.
Aber die Krippe erinnert auch an die bescheidenen Umstände, in denen Jesus geboren wurde. Es soll uns Menschen auch wieder ein wenig auf den Teppich holen – und sind wir mal ehrlich … das würde uns allen sehr gut tun!
Die Tradition der Weihnachtskrippe geht bis auf das frühe Mittelalter zurück. Im 13. Jahrhundert sollen die ersten Bauten dieser Szenerie gebaut – bzw. zusammengestellt worden sein.
Damals wie heute stehen die Figuren im Mittelpunkt. Ganz früher hat man die Figuren noch selbst aus Holz geschnitzt. Später wurden sie dann „massentauglich“ in Gips gegossen und heute gibt es ganze Sets aus Kunststoff. Aber die Sammelfreude hat irgendwie nicht ganz nachgelassen. Es gibt durchaus Krippenfans, die Jahr für Jahr eine neue Figur kaufen und die Szenerie erweitern. In Italien gab es die Krippenszene sogar im Ü-Ei zum sammeln. Auch Lego und Playmobil hatten es schon im Angebot.
Aber egal wie die Sammlung zustande gekommen ist – ganz wichtig ist, dass alle wichtigen Figuren komplett sind! Da ist natürlich das Jesuskind in der Krippe liegend. Dann folgen Maria und Josef, die liebevoll auf ihr Kind aufpassen.
Jetzt folgen auch schon Ochs und Esel, die ein Zeichen für die ärmlichen Verhältnisse sind, in denen Jesus zur Welt kam.
Wer natürlich nicht fehlen darf, sind die heiligen drei Könige. Sie werden meist mit ihren Geschenken dargestellt und werden als Letztes der Szenerie hinzugefügt.
Eine Krippenszene ohne Hirten und Schafe gildet nicht! Sie symbolisieren schließlich das einfache Volk, die als erste die frohe Botschaft verkündet bekamen.
Jetzt hätten wir noch den ein oder anderen Engel im Angebot … denn irgendwer mus ja die ganze Sache verkünden.
Oft wird die Krippe ja erst am 23. Dezember zusammen mit dem Tannenbaum aufgestellt, was oft mit Platzgründen zu tun hat. Da liegt Jesus meist direkt ind der Krippe. Andere beharren auf die Tradition, wo das Jesuskind erst an Heiligabend zugefügt wird. Manchmal kommen die heiligen drei Könige erst am 6. Januar hinzu, was dann ein extrem kurzer gastauftritt ist, weil dann der Baum und die Weihnachtsdeko ja auch schon wieder abgeräumt wird.
Es gibt ja echte Meisterwerke unter den Krippen. Ganze Dioramen mit der ganzen Szenerie … und sogar mit echtem Sand und so. Es gibt da so viele Möglichkeiten – von der einfachen Darstellung bis zu Detail reichen, oft sehr aufwendigen Szenerie.
Wer es etwas simpler mag, hat da vielleicht nur eine Klappkarte stehen, wo man die Karte aufklappt und Zack – steht der ganze Stall samt Figuren.
Es gibt Krippenbauer, die bauen Krippen auf Wunsch in die Region des Auftraggebers. So gibt es Krippenszenen aus dem Alpenland, wie auch direkt an der Küste oder am Strand.
Und auch die Figuren … In Zeiten der 3D-Drucker ist ja alles möglich. Da kann man auch die eigene Familie in den Stall setzen, die Peanuts, Simpsons usw.
Das hätte mit Weihnachten an sich vielleicht weniger zu tun – wär aber schon witzig.
Die Krippe – bzw. der Stall zu Bethlehem sollte in keinem Haushalt fehlen, finde ich. Schließlich geht es an Weihnachten ja genau darum und es erinnert uns vielleicht ein wenig daran, wer wir sind und woher wir kommen.

Krippenspiel

Es ist oft der Höhepunkt einer jeden Weihnachtsfeier in Schulen, Kindergärten und natürlich Kirchen. Das legendäre Krippenspiel – ein Theaterstück über die Weihnachtsgeschichte. In der Regel wird es von den Kindern aufgeführt … ob sie wollen oder nicht. Die Geschichte ist bekannt - die kennt so ziemlich jedes Kind.
Krippenspiele gibt es locker seit über 800 Jahren – also seit dem Mittelalter.
Einen Meilenstein der (Weihnachts)Geschichte schuf Franz von Assisi! Er lebte ja quasi das Leben der zwölf Jünger von Jesus … das bedeutet, er lebte in ärmlichen Verhältnissen. Er trug eine einfache Kutte, nur mit einem Strick gehalten, ging nach Möglichkeit barfuß und lehnte Geld rigoros ab. Vielleicht war das der Grund, warum das Krippenspiel erfunden worden ist … Er hatte einfach kein Geld und Material zur Verfügung um eine Krippe zu bauen – so nahm er Menschen und Tiere und inszenierte quasi das erste Krippenspiel. Oder zumindest eine der ersten Vorstellungen …
Damals wie heute stellt das Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte nach. Es werden die wichtigsten Szenen gezeigt. Als da wären die Herbergssuche, die Geburt im Stall von Bethlehem und natürlich die Verkündung der frohen Botschaft. Als Zugabe kommen dann die drei heiligen Könige mit ihren Geschenken.
Das Krippenspiel wird mittlerweile in vielen verschiedenen Arten interpretiert. Mal traditionell, mal modern und sogar als Musical.
Aber ganz egal wie das Krippenspiel gezeigt wird, ob gesprochen oder gesungen – es vermittelt stets die Botschaft von Weihnachten. Eine Geschichte voller Freude, Hoffnung und dem Wunsch nach Frieden. Was könnte besser in die Weihnachtszeit passen?!