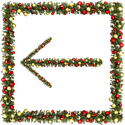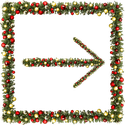Macht hoch die Tür´

Es begab sich vor langer Zeit … um genau zu sein 1623, da schrieb der Königsberger Pfarrer Georg Weissel den Text des Liedes „Macht hoch die Tür´“ für die Einweihungsfeier der Altroßgärter Kirche. Als Vorlage nahm er den Psalm 24, der zur Ankunft Jesu Christi aufruft. Daher passt es ja auch so gut in den Advent. Und schon nach fast 20 Jahren kam man auf die Idee, den Text 1642 zu veröffentlichen …
Im 17. Jahrhundert hat es eben manchmal etwas gedauert, aber Ok.
Gedauert hat es aber auch, bis aus dem Text ein Lied wurde … mehr oder weniger. Denn eine feste Melodie gibt es gar nicht. Der Text wird oft zur Melodie von "Ach Gott, wie manches Herzeleid" gesungen. Und dieses Stück stammt aus einer Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach. Das Stück wurde erstmals am 14. Januar 1725 aufgeführt und somit brauchte es fast 100 Jahre für die Entstehung des ganzen Liedes „Macht hoch die Tür´“. Heute geht das mit KI natürlich etwas schneller^^
Frei nach dem Motto: Gut Ding wil Weile haben, wurde es eines der bekanntesten und beliebtesten Adventslieder in Deutschland und wird meist in Gottesdiensten gesungen. Schon zu meiner Schulzeit war es ein Lied, dass nicht so wirklich den Weg in die Weihnachtsfeier fand. Dafür war es vielleicht ne Spur zu ernst ...

Makronen

Makronen sind ein sehr beliebtes Weihnachtsgebäck und gehören eindeutig zu den Klassikern auf dem Plätzchenteller. Makronen sind kleine fluffige Schaumkrönchen, die meist aus Eiweiß, Zucker und Kokosraspeln oder auch gemahlenen Mandeln und Nüssen bestehen.
Ursprünglich wurden Makronen aus Mandeln hergestellt. Zusammen mit Eiweiß und Zucker ergab das eine schöne weiche Masse. Und so kam das Gebäck auch zu seinem Namen. Der Name "Makrone" leitet sich nämlich vom italienischen Wort "maccarone" ab, was so viel wie "feine Masse" bedeutet. Daher ist es für mich auch fraglich, ob Makronen ihren Ursprung im arabischen Raum haben, wie oft behauptet wird. Sie sollen dann ihren Weg über den Mittelmeerraum bis nach Italien und Frankreich gefunden haben.
Irgendwann tauchten im 19. Jahrhundert die Kokosmakronen auf. Das hing mit dem vermehrten Import von Kokosnüssen zusammen. Da die genaue Herkunft gar nicht so richtig bekannt ist, kann uns das auch egal sein. Es hatte jedenfalls einen Hauch von Exotik und war mal was anderes auf dem bunten Teller. In der heimischen Weihnachtsbäckerei werden Makronen manchmal auf Oblaten gesetzt und dann eher im Backofen getrocknet als gebacken. Wichtig ist halt, dass sie eine leicht krosse Außenseite haben und innen drin megafluffig sind. Dann kann man sie noch mit Kuvertüre verzieren, wenn man möchte.
Makronen werden auch deshalb gern genommen, weil sie einfach relativ schnell zubereitet sind und wenig Zutaten brauchen. Trotzdem trumpfen sie mit ihrem charakteristischen Geschmack auf.
Bei uns waren Kokosmakronen Mamas Angelegenheit. Das hatte mit der Eiweißverwertung zu tun. Mama hat die Makronen immer in Kombination mit Spritzgebäck zubereitet, da dort nur Eigelb verwendet wurde. Das übergebliebene Eiweiß wurde dann in Makronen umgesetzt.
In vielen Haushalten ist das auch heute noch so. Diese Kombi ist oft ein fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Backens in vielen Familien … allein schon, weil es ja auch sehr oft Kindheitserinnerungen weckt.

Mandeln

„Haselnuss und Mandelkern, essen alle Kinder gern“. So – Thema erledigt! Nein, Quatsch - Mandeln spielen zu Weihnachten eine sehr große Rolle. Mandeln werden dermaßen vielfältig verwendet, dass es kracht. Zunächst sind sie schon mal durch ihre lange Haltbarkeit sehr beliebt. Und dann die ganzen Möglichkeiten, die sich je nach Rezept bieten … Sei es mal ganz, gehackt, gemahlen oder gehobelt … mal blanchiert oder unblanchiert … herrlich!
Mandeln kommen ursprünglich aus Südwestasien. Irgendwo so aus Südrussland, Afghanistan oder auch Iran, wo die Mandelbäume wild wachsen. Heute werden sie hauptsächlich im Mittelmeerraum und in Kalifornien angebaut – aber ich beziehe sie meistens aus dem Supermarkt^^
Mandeln gab es hier bereits im Mittelalter, waren damals aber eher für Haltbarkeit und dem Nährwert bekannt. Zucker war da allerdings noch ein Luxusgut, so dass man eben nur zur Weihnachtszeit auf den Genuss von Mandelgebäck kam. Denn bei den meisten Mandel-Spezialitäten stand Zucker ganz oben im Rezept.
So ab 1750 wurde Zucker erschwinglicher und die europäischen Back- und Süßwarenkunst konnte ihren Siegeszug antreten. Von da an rappelte es im Weihnachtskarton! Denn Mandeln verleihen Gebäck und Süßspeisen dieses unverwechselbare nussige Aroma und harmonieren perfekt mit all den weihnachtlichen Gewürzen.
Kommen wir zuerst auf die ganze Mandel. Als gebrannte Mandeln sind sie auf jeder Kirmes und natürlich dem Weihnachtsmarkt der absolute Klassiker! Da werden die ganzen Mandeln mit Wasser, Zucker und Gewürzen in einem Kupferkessel karamellisiert, und allein der Duft macht einen schon wahnsinnig.
Marzipan ohne Mandeln gibt es nicht! Man nehme gemahlene Mandeln, Rosenwasser oder Bittermandelöl und natürlich Zucker … alles gut vermengen und Zack – schon habt ihr Marzipan. Es ist eine DER Mandel-Spezialitäten zu Weihnachten, denn daraus werden dann so Köstlichkeiten wie Marzipankartoffeln, Marzipanbrote und kunstvolle Figuren.
Gehackte, gemahlene oder geröstete Mandeln finden sich in vielen vielen Rezepten wieder. Geröstet oder kandiert werden Mandeln auch gern zur Dekoration von Desserts und Gebäck verwendet. Die Liste der Weihnachtsgebäcksorten ist sowas von lang, dass ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Von „einfachen“ Weihnachtsplätzchen geht es über Zimtsterne und Vanillekipferl über Florentiner und Spekulatius bis hin zu Mandelhörnchen und natürlich dem Stollen. Viele Stollenrezepte enthalten ganze oder gehackte Mandeln, und bei mir z.B auch sehr gern eine feine Marzipanfüllungen.
Mandeln sind so vielseitig und dazu auch reich an gesunden Fetten, Vitamin E, Ballaststoffen und Mineralien. Aber uns interessieren ja eher die ganzen Weihnachtssüßigkeiten mit viel Zucker – also vergesst das mit dem gesunden Aspekt und genießt die Zaubereien aus der Weihnachtsbäckerei!

Märchen

Kommen wir zu einem kulturellen Erbe das von Generation zu Generation auf verschiedensten Wegen weitergegeben wird: Die Märchen!
Märchen werden erzählt, vorgelesen, als Hörspiel abgespielt oder als Film angesehen. Und auch - wenn die Welt sich stetig verändert, haben Märchen immer noch ihren Platz in der Weihnachtszeit. In der heutigen Zeit hat man ja eigentlich immer Zugriff auf die Medien bzw. Mediatheken, aber speziell in der Weihnachtszeit ist es noch etwas ganz Besonderes. Viele Märchen handeln von Themen wie, Familie, Liebe, Freundschaft, Gut gegen Böse, Hoffnung und Vergebung. Sie vermitteln den Kindern – aber auch uns Erwachsenen Werte, die man leider immer mehr vergisst. Allerdings ist man gerade zur Weihnachtszeit eher bereit, alte Werte wieder aufzufrischen und evtl. als guten Vorsatz für das kommende neue Jahr anzugehen.
Aber machen wir es uns nun gemütlich, kuscheln uns in die Decke und genießen ein Heißgetränk nach Wahl – Denn es wird märchenhaft.
Die sogenannten Weihnachtsmärchen sind eine ganz besondere Form der Märchen.
Auch wenn Märchen das Thema Weihnachten kaum – oder gar nicht beinhalten, sind gewisse Themen durchaus weihnachtlich oder winterlich angehaucht. So ist z.B. „Hänsel und Gretel“ schon mal das ein tolles Beispiel. Da ist weder Weihnachten, noch liegt da Schnee … Aber da kommt das Knusperhäuschen drin vor! Also ein ganz wichtiges Symbol in der Weihnachtszeit. Anders wie bei Schneewittchen … da ist höchstens der Name winterlich. Aber trotzdem ist es ein schönes Märchen.
Ein Märchen der ganz anderen Kategorie ist "Der Nussknacker". Das ist ein Märchen von E.T.A. Hoffmann, das oft Ballett in der Weihnachtszeit aufgeführt wird.
Und dann das Weihnachtsmärchen schlechthin: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"!
Dabei war der Film ja gar nicht als Weihnachtsmärchen geplant, aber das könnt ihr alles unter „D“ Nachlesen.
Als letztes Beispiel haben wir noch "Die Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens. Es ist die Geschichte über den geizigen Ebenezer Scrooge, der gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten zu einem besseren Menschen wird.
Gerade die letzten beiden Beispiele sind gute Beispiele, was Weihnachtstraditionen per Heimkino angeht. Aber egal, ob als Film, Buch oder sonst was – Es geht immer um Werte und Tugenden, die so enorm wichtig sind. Da geht es natürlich schon mal um Zusammenhalt und gemeinsame Zeit. Und es ist doch so schön, die Familie zusammen zu bringen, gemeinsam zur Ruhe zu kommen, ein Märchen hören oder sehen und zusammen über die wirklich wichtigen Themen nachzudenken. Und auch wenn das Märchen „nur“ zur Unterhaltung dient … Die Weihnachtszeit steckt oft so voller Hektik und Sorgen, dass ein schöner Märchenfilm oder auch ein gutes Märchenbuch einen aus dem grauen Alltag in eine wundervolle und magische Fantasie-Welt entführt.

Maria (Mutter von Jesus)

Wenn Maria nicht wär, gäbe es kein Weihnachten. Das ist einfach so. Aus heutiger Sicht ist die ganze (Weihnachts)Geschichte … na sagen wir mal – etwas merkwürdig. Dem christlichen Glauben wurde durch den Heiligen Geist mit Jesus schwanger und brachte ihn ohne Beteiligung eines menschlichen Vaters zur Welt. Heute ist das durch die moderne Medizin kein Problem … aber damals war es noch etwas schwierig. Und dann kommt noch der Punkt, dass Maria bei der Geburt Jesu etwa 13 bis 14 Jahre alt war. So wird zumindest vermutet.
Nun – das war früher halt so. Die Menschen sind aber auch nicht ganz so alt geworden … das muss man ja dazu sagen. Viele Frauen/ bzw. Mädchen sind da leider bei der Geburt verstorben …
Dagegen ist Maria sogar noch richtig alt geworden. Man weiß nicht genau, wann sie geboren wurde – und auch ihr Todesdatum ist nicht ganz sicher, aber es wird angenommen, dass sie in den Jahren zwischen 50 und 54 n. Chr. Starb … also Jesus und Josef überlebte.
Und obwohl sonst nicht wirklich viel über sie bekannt ist, wird sie in christlichen Tradition als Jungfrau Maria verehrt und in vielen Weihnachtskrippen und -Darstellungen.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Angabe richtig ist, dass sie die Ehefrau von Josef war … In vielen christlichen Traditionen wird Maria aber auch als "Mutter Gottes" verehrt, da sie ja Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt brachte.
Somit ist ihre Rolle in der Weihnachtsgeschichte und die Verehrung als Jungfrau Maria einer der Stützpfeiler der Weihnachtsgeschichte und im christlichen Glauben allgemein.

Maronen

Maronen kennt man auch als Edelkastanien oder wie im süddeutschen/österreichischen Raum, wo sie als Maroni bekannt sind. Maronen sind untrennbar mit der Herbst- und Weihnachtszeit verbunden. Ihr süßlich-nussiger Geschmack und ihr wärmender Charakter machen sie zu einem beliebten Genuss in den kalten Monaten.
Die Maronen haben wir den Römern zu verdanken. Die Edelkastanie (Castanea sativa) hatten die Jungs bei der Durchreise dabei und seit dem 16. Jahrhundert wurden sie dann auch in Bayern und anderen Regionen angebaut. Die Marone nennt man ja auch Esskastanie … aber man sollte sie jetzt nicht mit der Rosskastanie verwechseln! Das könnte übel ausgehen – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Rosskastanien wie sie bei uns oft in Parks und an Straßen stehen, sind ungenießbar und auch ziemlich giftig. Botanisch gesehen haben die beiden Arten so rein gar nichts miteinander zu tun. Ich sach nur^^
Die Maronen haben eine romantisch traditionelle Rolle auf dem Weihnachtsmarkt. Im Herbst und Winter gab es so ab dem 16. - 17. Jahrhundert auf dem Markt geröstete Maronen. Denn im Herbst und Winter hat die Edelkastanie Hochsaison und kann geerntet werden. Das war ein erschwinglicher und wärmender Happen … und diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Es ist wie bei gebrannten Mandeln … zieht der Duft von frisch gerösteten Maronen über den Weihnachtsmarkt, dann ist es das Zeichen, dass wir nun endgültig in der Vorweihnachtszeit angekommen sind. Frisch geröstete Maronen sind nicht nur lekka, sondern wärmen auch wunderbar von innen.
Sie sind aber nicht nur ein beliebter Snack auf Weihnachtsmärkten. Wenn zur großen Weihnachtstafel aufgetischt wird, finden sich Maronen gleich in mehreren Gängen beim Weihnachts-Menü wieder. Maronen sind eine gern genommene Füllung oder Beilage beim Gänsebraten. Mit Äpfeln oder Backpflaumen kombiniert passen sie herrlich zum deftigen Gänsefleisch. Und das vermeintlich schlechte Gewissen wird auch beruhigt, denn Maronen sind relativ kalorienarm. Dazu sind sie auch noch glutenfrei und fettarm. Also vorsichtshalber lieber noch ne Kelle Rotweinsoße dazu nehmen ….
Als Dessert gibt es dann anschließend „Marrons Glacés“ … also wenn man es kann^^
Diese Art der glasierten Maronen ist nämlich ziemlich aufwendig und dazu auch nicht ganz so günstig – aber lekka! Etwas günstiger ist da der „Mont Blanc“ - eine Süßspeise aus Frankreich. Das sind einfach pürierte Maronen mit einem Sahnehäubchen. Jetzt gibt es auch noch das Maronenmehl, das man in verschiedenen Rezepten für Weihnachtskuchen oder Brote wieder findet.
Ihr seht, Maronen sind also nicht nur ein köstlicher Snack für zwischendurch, sondern auch eine vielseitige Zutat. Ob nun in der herzhaften Weihnachtsküche oder der viel besungenen Weihnachtsbäckerei – immer her mit den Maronen.

Marzipan

Er kann – Sie kann – Marzipan! Marzipan ist eine sehr beliebte Süßigkeit, die viel und gern in der Weihnachtszeit genascht wird. Marzipan gibt es schon seit dem Mittelalter – so ziemlich zu dem Zeitpunkt an dem die Mandel den Weg zu uns gefunden hat. Marzipan besteht ja aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser – bzw. Bittermandelöl. Als Marzipan aus dem nahen Osten über Spanien zu uns kam, galt es teilweise noch als Arznei … setzte sich aber dann doch eher als Süßigkeit durch. War vielleicht zu süß für eine Medizin^^
Wenn man in Deutschland an Marzipan denkt, denkt man in der Regel automatisch an Lübeck. Das kommt daher, dass man dort um 1805 die ersten Marzipanmanufakturen gegründet hat. Von dort kommt besonders hochwertiges Marzipan, das einen sehr hohen Anteil an Mandeln und eher wenig Zucker hat.
Marzipan hat ja eine lange Geschichte und ist eng mit Weihnachten verbunden, da die Zutaten früher sehr teuer waren und es nur zu besonderen Anlässen wie Weihnachten hergestellt und verkauft wurde.
In der Weihnachtsbäckerei verwendet man Marzipan als Marzipandecke für Torten, als Dekoration für Gebäck, oder als modellierte Figur. Ebenso gibt es Marzipan als eigenständiges Gebäck, wo es aber eher geröstet – bzw. getrocknet ist.
Als Füllung greift man heutzutage eher zum Persipan, weil das etwas günstiger ist – aber in der Kombination mit einem Stollen z.B. genau so lekka ist. Jetzt gibt es Marzipan das ganze Jahr über. Von daher ist der Hinweis, dass man Marzipan vor Licht und Wärme schützen soll zwar hilfreich – in meinem Fall aber völlig sinnlos^^ So lange hält das hier nicht …
Besonders Marzipanbrot und Marzipankartoffeln sind ein absolutes MUSS für mich.
Das gehört einfach in die Weihnachtszeit dazu – und zu Silvester ist ein kleines Marzipanschweinchen ein feines Mitbringsel.

Melchior

Melchior ist der dritte im Bunde der heiligen Könige. Balthasar und Caspar hatten wir ja bereits. Und die Story mit dem Stern und so hatten wir auch schon mehrfach. Der Überlieferung nach stammt Melchior aus Europa und wird bildlich meist als älterer Mann mit weißem Bart und weißen Haaren dargestellt und er trägt eine Krone. Vermutlich der reichste der drei Könige, weil auch er es ist, der dem Jesukind das Gold mitgebracht haben soll. Die andere Möglichkeit: Melchior brachte das Gold als Symbol für Jesus als König, seine göttliche Natur und die Herrschaft im Christentum.
Und auch, wenn wir nicht so viel über ihn wissen, gehört er zur Krippenszene in der Weihnachtsgeschichte dazu.

Mistelzweig

Ein schöner Brauch kommt aus Großbritannien. Der Mistelzweig mit seinen Traditionen. Wir haben es hier wieder mit den Ursprüngen im heidnischen – bzw. in alten nordischen Mythen und Bräuchen zu tun. In vorchristlichen Zeiten haben Druiden aus Misteln heilende Tränke gebraut. Zugegeben, das klingt jetzt ein wenig nach „Asterix und Obelix“. Und so war es ja auch. Bevor die beiden in ein neues Abenteuer marschiert sind, hat der Druide Miraculix erst ein mal Zaubertrank gebraut … und zwar aus Misteln, die er mit einer goldenen Sichel geerntet hat.
Das ist durchaus keine Erfindung. Die „echten“ Druiden hatten ebenso eine goldene Sichel für die Misteln. Allerdings wurden dann Mittel gegen Bluthochdruck, Herzbeschwerden und Gelenkerkrankungen gebraut. Also war es je nach Wirkung schon so etwas wie Zaubertrank. Jetzt wisst ihr auch, warum Obelix so ein gutes Herz hat … weil er als Kind in den Kessel mit Zaubertrank gefallen ist. Aber da fällt mir etwas ein: Kann es sein, dass ich gerade ein wenig vom Thema abschweife?
Kommen wir wieder zum Thema.
Mittlerweile findet man Mistelzweige überall in der Welt als Weihnachtsdekoration. Oft als Begleiterscheinung internationaler Weihnachtsfilme. Dummerweise wird die Mistel oft mit Ilex verwechselt … was aber vielleicht auch an Frank Sinatra liegt, der einst das Weihnachtslied Mistletoe an Holly gesungen hat … also Mistel und Ilex.
Mistelzweige sind aber nicht nur ein beliebter Weihnachtsschmuck, sondern auch ein Symbol für Glück, Liebe und Frieden. Dafür steht auch der Brauch, sich unter einem Mistelzweig zu küssen. Das soll dem Paar Glück bringen und dem Flurfunk in der Firma neuen Gesprächsstoff, wenn es denn bei der Betriebsweihnachtsfeier passiert ist^^
Der Kuss unter dem Mistelzweig steht natürlich für die Romantik zwischen zwei Menschen in der Weihnachtszeit. In manchen Traditionen steht der Kuss quasi als Verlobung … zumindest erst einmal als ein Versprechen für die ewige Liebe, was ja manchmal etwas voreilig ausgesprochen wird.
Die Mistel wurde in der nordischen Mythologie auch als friedensstiftend angesehen, was sich in dem Brauch des Friedenskusses unter dem Mistelzweig wiederfindet.
Vielleicht sollte man in Krisengebiete mal öfter Jagdbomber drüber schicken, damit dort Misteln abgeworfen werden … natürlich mit Anleitung dieses Brauches!
Mistelzweige werden aber auch oft einfach so als Glücksbringer aufgehängt, an Fenstern oder Türen zum Beispiel. Natürlich besonders zu Weihnachten – bzw. zum Jahresende, um den Schutz vor bösen Geistern und Unglück zu wahren.
Meist ist es aber einfach nur Dekoration. Gern nimmt man rote Schleifchen oder Bänder dazu – oft auch in Kombination mit Tannengrün.
Kleine Mistelzweige werden sogar als Geschenkanhänger verwendet. Damit wünscht man dann nicht nur frohe Weihnachten, sondern packt auch gleich etwas Glück für das kommende Jahr dazu. Sie haben eben eine ganz besondere Bedeutung in der Weihnachtszeit, weil sie für Liebe, Frieden und Glück sorgen sollen.

Mitternachtsmesse

Wenn die Christmette (wie die Mitternachtsmesse auch genannt wird) beginnt, ist die Messe an Heiligabend eigentlich gelesen^^ Diese festliche kirchliche Feier findet in der Christnacht statt – also vom 24. auf den 25. Dezember und markiert den kirchlichen Beginn des Weihnachtsfestes und erinnert an die Geburt Jesu Christi.
Allerdings ist das ja auch schon wieder geflunkert … denn oft beginnt die Mitternachtsmesse schon um 22:00 oder 23:00 Uhr. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde anders. Da wird die Christmette gern vorverlegt, damit auch ältere Menschen und Kinder dabei sein können. Ob sich das nun wirklich auswirkt, weiß ich nicht, da ich so spät nirgends wo mehr hin gehe.
Zudem überschneidet sich die Messe ja auch mit dem TV-Programm, das in vielen Familien mehr Tradition hat, als in die Kirche zu gehen. Aber es gibt auch fromme Familien, die eine ganz andere Form der Tradition leben. In manchen Familien ist es nämlich üblich, dass die Geschenke erst nach der Mitternachtsmesse ausgepackt werden. Blicken wir in die USA, nach Frankreich und nach England, wird so ein Schuh draus, dass die Bescherung erst am Morgen des 25. Dezember über die Bühne geht.
Aber egal, wie es abläuft - Die Mitternachtsmesse ist ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtsfeierlichkeiten in der Kirche und vielen Familien.
Die Christmette ist ein extrem feierlicher Gottesdienst, der die Geburt Jesu Christi feiert. Da wird dann alles geboten, was die örtliche Gemeinde so zu bieten hat. Mit vielen Kerzen, nen guten Schwung Weihrauch und festlicher Musik lässt man es dort gut krachen. In der Messe selbst werden traditionell weihnachtliche Lieder gesungen, Gebete gesprochen und die obligatorische Predigt darf natürlich auch nicht fehlen. Dabei hält sich die Predigt in der Regel auf die Weihnachtsgeschichte … in der Regel^^ In der heutigen Zeit driftet man dabei aber auch gern mal in politische und ideologische Themen ab – warum auch immer … es ist nämlich DIE Mitternachtsmesse, in der man die Geburt Jesu Christi feiert! Und selbst die Menschen, die es sonst mit der Kirche nicht so haben, möchten dann ein festliches Weihnachtsfest erleben.

Morgen kommt der Weihnachtsmann

"Morgen kommt der Weihnachtsmann" ist ein traditionelles deutsches Weihnachtslied das von der Vorfreude auf den Weihnachtsmann und seine Gaben erzählt. So um 1840 hat Hoffmann von Fallersleben den Text verfasst und sich dazu die Melodie von dem französischen Volkslied "Ah! vous dirai-je, Maman" ausgeliehen. Diese Melodie wurde später auch als "Twinkle, Twinkle Little Star" bekannt.
"Morgen kommt der Weihnachtsmann" gehört zu den fröhlichen Weihnachtsliedern, das gerne von Kindern gesungen wird. Es geht schließlich um die Bescherung und die herrlichen Geschenke. Und sind wir mal ehrlich … die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist doch die schönste Freude.

Morgen, Kinder wird’s was geben

Mit Vorfreude geht es auch gleich weiter. Denn wenn morgen der Weihnachtsmann kommt, weiß jedes Kind: "Morgen, Kinder, wird's was geben". Den Text für dieses bekannte deutsche Weihnachtslied hat Karl Friedrich Splittegarb verfasst und wurde 1795 unter dem Titel "Die Weihnachtsfreude" veröffentlicht.. Vertont wurde das Werk dann im Jahre 1809 von Carl Gottlieb Hering. Die Melodie stammt von einer Berliner Volksweise ab. So um 1811 kam eine weitere Fassung zu demselben Text. Und auch diesmal war der Ursprung eine Berliner Volksweise – möglicherweise ein Kinderlied.
Mir sind beide Melodien bekannt (welch Überraschung) – allerdings hat sich die 1809er Version mehr durchgesetzt.
Das Lied – bzw. der Text hat sich über die Jahre hinweg immer wieder ein wenig angepasst und hat es bis zu vielen bekannten Künstlern geschafft. Sogar Wolfgang Petry hat das Lied auf seinem Weihnachtsalbum heraus gebracht.
"Morgen, Kinder, wird's was geben" ist jetzt nicht unbedingt als religiöses Weihnachtslied bekannt. Der Text beschreibt eher die Vorfreude der Kinder und die dazugehörige Vorfreude auf die Bescherung. Es war ein erster Wink zur Konsumgesellschaft, wo es an Weihnachten nur um Geschenke mit materiellem Wert geht.
Egal – es ist ein fröhliches Weihnachtslied über die kindliche Vorfreude zum Höhepunkt der Weihnachtszeit – der Bescherung.

Morgenland

Wenn wir vom "Morgenland" reden, dann meist im Kontext zu Weihnachten – bzw. den heiligen drei Königen. Es bezieht sich auf die Herkunft der drei Wiesen aus dem Morgenland. Es wird laut Bibel also genau gesagt, wo die drei Könige her kommen und trotzdem weiß es kaum jemand genau. Liegt mitunter daran, dass man bei uns ja so gut wie nie „Morgenland“ sagt. Wir reden da eher vom nahen Osten, Orient oder auch Vorderasien. Noch genauer betrachtet sind das dann so Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan oder die Türkei. Ihr könnt ja mal aus Spaß in den Nachrichten genau zuhören, wann – bzw. ob vom Morgenland die Rede ist …
Jedenfalls hat man so dann ungefähr nen Plan, wie weit die drei Weisen aus dem Morgenland gewandert sind, um nach Bethlehem zu kommen.
Es gibt sicher weitere Strecken, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass sie zu Fuß unterwegs waren. Da zeigt es sich dann auch, dass es von Vorteil ist, Sterne deuten zu können.
Die Geschichte von der Reise, die Caspar, Melchior und Balthasar auf sich genommen haben, ist Teil ein wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte. Auch wenn dieser Weg nicht weiter beschrieben ist. Die Fakten, die wir kennen: Sie waren zu dritt – sie folgten einem Stern – hatten Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei und kamen aus dem Morgenland zum Jesukind. Und ehrlich gesagt, reicht das auch für die weihnachtlichste Geschichte schlechthin.

Muskatnuss

Muskat ist ein unverzichtbares Gewürz in der Küche allgemein – und natürlich zur Weihnachtszeit. Dabei reden wir noch nicht mal groß von Düften – aber dafür von den charakteristischen Aromen. Das hat sich schon recht früh rumgesprochen.
Erstmals kam die Muskatnuss im 12. Jahrhundert durch arabische Händler nach Europa. Allerdings gibt es wohl Belege, dass bereits im 11. Jahrhundert Muskat im Rheinland verwendet wurde. Man hat damit Bier aromatisiert. Das war zu der Zeit unerhört wertvoll und so richtig richtig teuer, dass man mit diesem Gebräu sehr sparsam umging. Da es darüber keine Handelsbriefe gibt, gehe ich fast von einem Geschenk oder einem Probe-Päckchen aus ...
Im 13. Jahrhundert konnte man es dann so einrichten, dass die Handelsschiffe so halbwegs regelmäßig die Muskatnuss im Gepäck hatten. Damals war Muskatnuss ja noch ein Statussymbol und eher ein begehrtes Heilmittel (Stichwort Bier^^).
So richtig los ging es dann im 16. Jahrhundert, als sich die Portugiesen und etwas später die Niederländer in das Geschäft eingemischt haben. Es war 1512, als die Portugiesen unter Afonso de Albuquerque den Seeweg zu den Gewürzinseln (heute Indonesien) entdeckten und das Gewürz als Handelsware einführten. Wie immer bei begehrten Dingen hat man versucht, die Probleme mit Krieg zu regeln. Die Kontrolle über den Muskatnuss-Handel führte nämlich zu Kriegen zwischen europäischen Mächten wie Portugal, Spanien, England und den Niederlanden. Am Ende haben sich die Niederländer das Monopol der Muskatnuss gesichert und konnte es bis ins 18. Jahrhundert halten.
Mit der Etablierung des Weihnachtsfestes im 18. Jahrhundert fanden Gewürze, wie die Muskatnuss, ihren festen Platz in der festlichen Küche. Auch wenn es da immer noch ein teures Vergnügen war … Im 20. Jahrhundert kam dann der globalisierte Handel. Kostbare Gewürze wurden erschwinglicher und landeten dann auch öfter in den Weihnachtsküchen der Mittelklasse.
Das war jetzt ein langer Text zum historischen Kontext – aber das musste sein. Heute gehen wir einfach in den Supermarkt und kaufen ein Tütchen oder ein Glas mit diesen einst so kostbaren Gewürzen.
Und auch, wenn es nun nicht mehr so teuer ist, wie früher … sollte man sparsam mut Muskat umgehen! Ab etwa 5 – 10 Gramm kann Muskat toxisch wirken - Bei Kindern übrigens deutlich weniger! Da kann es zu Übelkeit kommen, Herzrasen und sogar Halluzinationen, wo selbst Erwachsene plötzlich wieder an den Weihnachtsmann glauben …
Daher am besten immer nur eine Prise frisch reiben – das reicht nämlich völlig aus, um das volle Aroma zu entfalten. Und das Aroma der Muskatnuss ist komplex und passt hervorragend zu den traditionellen Winter- und Weihnachtsgerichten. Bei mir ist Muskat das ganze Jahr im Einsatz … aber Ok – ich denke ja auch das ganze jahr an Weihnachten^^ Aber ernsthaft – bei Kartoffelpüü, Kartoffelstampf, Rosenkohl, Erbsen und Möhren (bei uns „Mörbsen) usw. - immer ist Muskat dabei. Zur Weihnachtszeitgehört auch eine Prise Muskat in den Rotkohl oder Grünkohl, die ja beliebte Beilagen zum Weihnachtsbraten sind. Und auch in der dunklen Soße können ein paar Krümel Muskatnuss nicht schaden.
Eine Prise frisch geriebener Muskatnuss verfeinert auch diverse Heissgetränke. Ob nun Glühwein, Kinderpunsch oder Eierpunsch – es ist immer wieder ein aromatisches Erlebnis.
Nicht zu vergessen – die Weihnachtsbäckerei! Denn auch dort ist die Muskatnuss natürlich in Verwendung. In Lebkuchen und Spekulatius findet man oft Muskatnuss mit den vielen anderen Weihnachtsgewürzen wie Zimt, Nelken sowie Kardamom und Anis. Auch in einigen Stollenvarianten wird Muskatnuss zusammen mit anderen Gewürzen für das Aroma des Teiges verwendet – ist aber kein Muss.
Muskatnuss veredelt süße wie auch herzhafte Speisen (und Getränke) und ist ein weihnachtliches Aromawunder. Es schmeckt einfach nach Weihnachten.

Myrrhe

Wer kennt sie nicht? „Er steht im Tor“ … „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ … „Eine Mark für Charly“ usw. Das alles sind Hits von Wencke Myhre … aber ich merke grade ich habe ein paar Wechstaben verbuchselt^^
Myrrhe ist das gesuchte Wort …
Ohne die Weihnachtsgeschichte würden viele Menschen gar nichts mit Myrrhe anfangen können. Die Myrrhe war eines der drei Geschenke, die die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind brachten.
Im alten Israel hat man es für die Salbung der Toten genommen und daher steht die Myrrhe symbolisch für das Leiden und den Tod Jesu. Andererseits steht sie auch mit Heilung und Reinigung in Verbindung gebracht. Dazu hatte Myrrhe auch noch desinfizierende Eigenschaften. Ist schon ganz praktisches Zeug. Es ist ein Gummiharz, das man aus dem Myrrhenbaum gewinnt, der in Ostafrika und Südarabien wächst. Und dieses Gummiharz qualmt auch ganz gut … Daher nimmt man auch heute noch Myrrhe als Räuchermittel genommen. Es schafft eine besinnliche Atmosphäre … in welche Richtung das auch immer gehen mag …
Myrrhe kann wird auch gern als Schutz- und Reinigungsweihrauch verbrannt, sowie als Weihgabe für die Götter bei mystischen Räucherungen genommen. Ja ja – so nimmt die Myrrhe den Weg vom christlichen Weihnachtsfest zu heidnischen Bräuchen. Aber es war – ist – und bleibt ein wichtiger der Weihnachtsgeschichte.