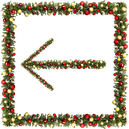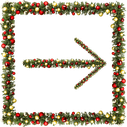Oblaten

Schon die Beatles haben davon gesungen. „Oblati, Oblata“ hieß das Lied damals … glaub ich. Oblaten haben in der Weihnachtszeit einen doppelten Verwendungszweck.
Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen, wobei man die runden Oblaten wohl am meisten nutzt. Es gibt sogar geprägte oder bedruckte Oblaten … natürlich mit Lebensmittelfarbe. Und dann haben wir noch Oblaten, die wie kleine runde Waffeln aussehen (siehe Bild) und eher als kleiner Happen zwischendurch zu sehen sind.
Fangen wir in der Weihnachtsbäckerei an. Da haben wir die Backoblaten, die in der Regel als Unterlage für Makronen, Lebkuchen oder andere Gebäcke verwendet werden. Es sind dünne essbare Scheiben – manche kennen sicher den Begriff „Esspapier“. Oblaten sind im Prinzip ja nichts anderes. In der Regel sind sie aus Weizenmehl und Stärke … und ziemlich dünn. Man könnte zwar … aber Backoblaten sind eigentlich nicht dazu gedacht, sie als Snack zu vernaschen. Passiert trotzdem manchmal^^ Vielmehr nimmt man Backoblaten deshalb, weil sie dafür sorgen, dass die Gebäcke länger frisch bleiben und manchmal einen zusätzlichen zarten Biss haben.
Die Oblate hat aber auch noch einen anderen Job – den der Hostie. In der katholischen Kirche verwendet man sie zur Eucharistie, wo die Hostie das Brot symbolisiert, welches Jesus beim letzten Abendmahl teilte.
Das hat man in einigen Kulturen dann als Weihnachtstradition übernommen. So ist die Tradition des Oblatenteilens in Ländern wie Polen, Italien, Tschechien, Litauen, der Ukraine, der Slowakei und Ungarn verbreitet.
Das Brechen der Oblate wird dann oft von Gebeten oder dem Vorlesen der Weihnachtsgeschichte begleitet. Dieser Vorgang ist ein Zeichen der Liebe, Freundschaft und Versöhnung, bei dem man sich auch gegenseitig Glück und Segen für das kommende Jahr wünscht.
Diese Tradition geht wohl auf die frühe christliche Praxis zurück, wo man das Brot mit der Familie und Freunden geteilt hat. Ganz früher hat man dafür geweihtes Brot genommen … wurde aber dann im 10. Jahrhundert durch Oblaten ersetzt, weil das wohl nen Tacken einfacher war.
Aber ganz egal, ob man nun Backoblaten in der Weihnachtsbäckerei verwendet – oder mit ihnen christliche Rituale durchführt … Sie gehören zur Weihnachtszeit dazu, wie man im Supermarkt ja auch unschwer erkennen kann, wenn gewisse Backzutaten und Weihnachtsbackmischungen in den Regalen stehen.

Ochs und Esel

Bei den meisten gibt es ja zu Weihnachten Ente oder Gans – aber wir reden hier jetzt über Ochse und Esel. Man findet sie eigentlich immer an oder in der Krippe unter dem Tannenbaum, denn sie haben eine tiefe symbolische Bedeutung. Interessant dabei ist die Tatsache, dass Ochse und Esel in der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium gar nicht vorkommen …
Liegt vielleicht daran, dass sie erst seit dem 4. Jahrhundert Teil der Weihnachtsgeschichte sind, aber quasi die ganze Geschichte von Jesus prophezeien.
Ochse und Esel sind nicht einfach nur Tiere - Sie symbolisieren die Welt, die Jesus empfängt … und seine Rolle als Retter der Menschheit.
In der Jesaja-Prophetie wird die Darstellung von Ochse und Esel in der Krippe mit der Prophetie des Propheten Jesaja in Verbindung gebracht. Diese besagt, dass Ochse und Esel den Besitzer und die Krippe ihres Herrn kennen, während das Volk Israel keine Erkenntnis hat.
Und da es bei Weihnachten sehr oft um Heiden geht, kommen sie auch diesmal wieder ins Spiel … In der christlichen Interpretation steht der Ochse oft für das Volk Israel, und der Esel für die Heiden. Dabei wird der Ochse gelegentlich mit einem Joch dargestellt, das das jüdische Gesetz symbolisiert – und der Esel trägt die Last des Götzendienstes der Heiden … weil er es kann.
Auch wenn wir Ochse und Esel dann doch eher meist als Beiwerk in der Krippe sehen, haben sie eine weit aus tiefere Bedeutung: Durch die Geburt Jesu wird sowohl das jüdische Volk als auch die Heiden von ihren jeweiligen Bindungen befreit.
Ziemlich trockener Stoff – geb ich zu, aber auch irgendwie interessant. Ochse und Esel sind mehr als nur Tiere, die in der Weihnachtsgeschichte wie Statisten im Film in der Gegend rum stehen. Sie sind Symbole für die Welt, die Jesus empfängt, und für die Hoffnung auf Erlösung, die mit seiner Geburt verbunden ist.

Oh du fröhliche

Den Udo Fröhliche hatten wir ja schon … Singen wir jetzt das bekannte deutsche Weihnachtslied „O du Fröhliche". Ursprünglich war das Lied gleich für drei christliche Feiertage gedacht. Wir wünschen ja heute noch frohe Ostern, frohe Pfingsten und frohe Weihnachten. Die Melodie stammt von dem sizilianischen Seemannslied "O Sanctissima", das von Johann Gottfried Herder in seine Sammlung aufgenommen wurde. Der Johann war in Sachen so etwas, wie die Gebrüder Grimm bei den Märchen – ich sach nur …
Den Text für die erste Strophe schrieb Johannes Daniel Falk für Waisenkinder in Weimar. Die brauchen nicht so viel … da reicht eine Strophe^^
Die zwei weiteren Strophen wurden Heinrich Holzschuher hinzugefügt.
Dadurch wurde „O du Fröhliche" ja dann auch zu einem reinen Weihnachtslied umgewandelt. Wie gesagt basiert das Lied auf ein Marienlied, das von Seefahrern gesungen wurde. Und Nikolaus war ja auch Schutzpatron der Seefahrer – so ein Ding ist das nämlich.
Im Großen und Ganzen ist "O du Fröhliche" ein Lied der Freude und des Dankes für die Geburt Jesu und die Erlösung, die er bringt. Es ist bis heute eines der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder weltweit. Es gibt ja da auch noch eine Verhohnepiepelung von Otto Waalkes, der zu Weihnachten immer „Otti Fröhliche“ singt. Was Udo Fröhliche wohl dazu sagt ...

Oh Tannenbaum

"Oh Tannenbaum" ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder, das es weit gebracht hat. Um genauer zu sein … es wird Weltweit gesungen - So ist die Melodie z.B. die Grundlage der Hymne des US-Bundesstaates Maryland - "Maryland, My Maryland".
Die Melodie dazu gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Möglicherweise war diese Volksweise damals so etwas wie ein Hit, zu dem getanzt wurde.
Der Text zu "Oh Tannenbaum" wurde 1819 ursprünglich von August Zarnack geschrieben … bzw. die erste Strophe. War wohl textmäßig eine sparsame Zeit^^
So ähnlich dachte wohl auch Ernst Anschütz und verfasste 1824 eine zweite und dritte Strophe. Und genau so wurde es dann 1824 veröffentlicht und wurde weltberühmt.
Das Lied hat sich zu einem Symbol für Weihnachten entwickelt und seitdem wird damit bei vielen Familien die Bescherung eröffnet.
"O Tannenbaum" ist nicht nur einfach ein Weihnachtslied, sondern auch ein Lied mit einer reichen Geschichte und vielfältigen Interpretationen – darunter wie gesagt, sogar die Hymne des US-Bundesstaates Maryland.
Es ist eben ein vielseitiges Lied, das unter anderem für Parodien herhalten musste und sogar beim Fußball in Stadien gesungen wird. Aber mir ist es dann doch als Weihnachtslied am Liebsten.

Orangeat

Mit dem Orangeat ist es wie mit Rosinen … die einen lieben es, die anderen hassen es. Dabei ist Orangeat eine klassische Zutat in der Weihnachtsbäckerei, die für viele untrennbar mit den traditionellen Aromen der Advents- und Weihnachtszeit verbunden ist. Es handelt sich bei Orangeat um kandierte Orangenschalen, die eine süßlich-herbe und leicht bittere Note zu Gebäck beisteuern.
Dafür wird zuerst die Schale von der Orange gelöst, wobei das weiße Fruchtfleisch auf der Innenseite so weit wie möglich entfernt werden sollte. Das ist nämlich etwas bitter. Dann werden die Schalen gewürfelt – oder auch in dünne Streifen geschnibbelt … je nachdem, wie man es mag.
Um die Schalen etwas weicher zu machen und Bitterstoffe zu reduzieren, werden die Würfel – bzw. Streifen mehrfach in Wasser gekocht, wobei das Wasser zwischendurch natürlich gewechselt wird.
Nun wird das halbfertige Orangeat in einer Zuckerlösung gekocht. Dadurch werden sie haltbar und leicht durchsichtig. Das kann jetzt natürlich ein paar Tage dauern, weil so die Zuckerkonzentration schrittweise erhöht wird.
Jetzt nur noch alles auf die Wäscheleine … nee, Quatsch^^^Zum Trocknen legt man die Streifen oder Würfel auf ein Gitter, bis sie nicht mehr kleben. Manchmal wird das Orangeat noch zusätzlich in Zucker gewälzt, um ein Verkleben zu verhindern. Na ja … zudem werden sie eben noch süßer und auch haltbarer. Aber warum schreib ich das alles? Ganz einfach – damit ihr Orangeat auch selbst herstellen könnt. Ihr wisst genau, was drin ist und es schmeckt nicht irgendwie künstlich … was schon mal passieren kann.
Die Vorbereitung dauert natürlich etwas, aber glaubt mir – es lohnt sich. Man muss einfach etwas früher anfangen. Allgemein empfehle ich ja, so ab August, September mit Vorbereitungen und dem Einkauf anzufangen, da die ganzen Zutaten ja irgendwie doch ein teurer Spaß sind …
Orangeat ist eine der Schlüsselzutaten in der Weihnachtsbäckerei. Ist einfach so!
Besonders in den traditionellen Rezepten für Christstollen und Früchtebrote gehört Orangeat dazu. Stellt euch mal einen Dresdner Stollen mit ohne Orangeat vor … geht ja gar nicht^^
Dann gibt es neben Lebkuchen ja auch noch andere Plätzchen, in denen man Orangeat findet. Das gibt dem Ganzen noch eine fruchtige Note.
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass kandierte Früchte wie eben das Orangeat in der Historie einen ähnlichen Status hatten, wie Gewürze. Sie standen für Wohlstand und waren damals schon etwas ganz Besonderes und eher selten. Daher fand man Orangeat eigentlich immer schon überwiegend zur Weihnachtszeit in den süßen Weihnachtsleckereien.

Orangen

Die Orange ist eine weihnachtliche Zugabe, die seit frühester Zeit ein Zeichen für Wohlstand war, heute aber eher auf fruchtige Art und Weise für Wärme und Sonne steht, was besonders in der dunklen Jahreszeit eine willkommene Botschaft ist.
Zuerst gelangte die eng verwandte Bitterorange im 11. Jahrhundert nach Europa.
Die „normalen“ süßen Orangen kamen dann im 15. Jahrhundert über Portugal nach Europa und zogen als Apfelsine in deutsche Landen ein. Es gibt Regionen, da bezeichnet man die Orange auch als "Weihnachtsapfel". Quasi als Ergänzung zum Nikolausapfel, der ja ein echter Apfel ist. Allerdings hat sich der Nikolaus auch schon an Apfelsinen bedient. Der Legende nach, hat Nikolaus Orangen als goldene Geschenke an arme Kinder verteilte, um ihnen eine Freude zu machen. Irgendwer hat ihm dann gesagt, dass Orangen kein Gold wären – ebenso wie Schweden keine Holländer sind^^
Bei vielen Familien gehört eine Orange zum bunten Weihnachtsteller einfach dazu. Ganz egal, ob arm oder reich – Aber die Orange als Geschenk für arme Kinder zieht sich über Jahrhunderte durch die Geschichte. Es gibt da auch einen schönen Weihnachtsfilm, der von einem Waisenkind erzählt, das eine Orange zu Weihnachten erhält. Ich hab euch "Orangen zu Weihnachten" mal verlinkt. Nehmt euch nen Punsch oder einen Glühwein, pellt euch ne Apfelsine und genießt den Film an einem schönen Abend im Advent. So geht nämlich Weihnachtszeit.